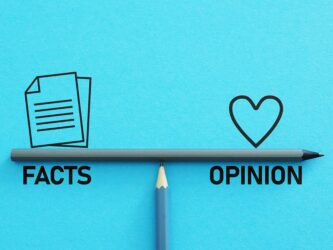Angesichts der zahllosen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind und auch in Europa nach einer mindestens vorübergehenden Bleibe suchen, erinnere ich mich an die Fluchterfahrungen der jüdisch-deutschen Dichterin Hilde Domin. Von Franziska Loretan-Saladin
Ich habe mich vor rund zehn Jahren im Zusammenhang mit meiner Arbeit über die Sprache der Dichtung und die Sprache der Predigt intensiv mit ihrem lyrischen und dichtungstheoretischen Werk auseinandergesetzt 1. Die existenzielle Grunderfahrung ihres Lebens floss in viele ihrer Gedichte ein. Sie bleiben eine Ermutigung auch heute.
Fluchterfahrung und Sprachfindung
Hilde Domin flüchtete zusammen mit ihrem Mann Erwin Walter Palm mit Zwischenstationen in Rom und London vor dem antisemitischen Rassenwahn Hitlers und seines Regimes bis in die Karibik. In Santo Domingo fanden sie schliesslich Zuflucht für die kommenden Jahre. Hier, am „Ende der Welt … Fremder ging es nicht mehr“ (GA 56), begann die promovierte Politikwissenschaftlerin zu schreiben. Es war für sie wie eine zweite Geburt. Als „Spracharbeiterin“ schrieb sie gegen das Sterben an. „Solange ich schrieb, lebte ich.“ (GA 177) Die Sprache wurde für Hilde Domin zum Unverlierbaren, „nachdem alles andere sich als verlierbar erwiesen hatte. Das letzte, unabnehmbare Zuhause.“ (GE 14)
Diese beiden existenziellen Erfahrungen, die Flucht in ein Exil am Ende der Welt und die „Heimkehr ins Wort“, prägen das Werk Hilde Domins. Bei der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Jahr 1979 stellte die Dichterin ihren Lebenslauf ganz von der Sprache her dar, ein „Leben als Sprachodyssee“ (GA 32-40). Von Deutsch über Italienisch und Englisch zum Spanisch machte sie sich zusammen mit ihrem Mann beim Lesen und Vorlesen von Gedichten in der fremden Sprache heimisch. In England unterrichtete sie an einem College in Somerset Französisch und Italienisch, oder auch Latein. Sie übersetzte die wissenschaftlichen Arbeiten ihres Mannes – er war Archäologe – vom Italienischen zunächst ins Englische und dann ins Spanische. Kein Wunder erklärt sie von sich, „dass ich Texte gewendet habe, wie andere Kleider wenden.“ (GA 39)
Vom Tod ihrer Mutter nur aus der Ferne und beinahe zufällig erfahren zu müssen, erschütterte Hilde Domin zutiefst. Sie fand aus diesem Schock erst durch das Schreiben wieder Tritt im Leben. Trotz ihrer Vielsprachigkeit und obwohl Deutsch die Sprache der Verfolger war, wurde die Muttersprache zur Sprache ihrer Dichtung. Sie war sich dieses Zwiespalts durchaus bewusst, wenn sie in einem Offenen Brief an Nelly Sachs vom Dichter im Exil schreibt:
„… er [der Dichter, die Dichterin] kann nicht anders als die Sprache lieben, durch die er lebt und die ihm Leben gibt. In der ihm doch sein Leben beschädigt wurde. Das äusserste Vertrauen und die Panik fallen hier zusammen, das Ja und das Nein sind nie mehr zu trennen.“ (GA 173)
Das Paradox, das in dieser Erfahrung steckt, wird zu einem Kennzeichen von Hilde Domins Lyrik.
Das Paradox der Existenz
Das Leben im Paradox ist wohl eine für Flüchtlinge aller Zeiten gültige Metapher. Unfreiwillig sind sie in einem fremden Land, suchen hier Schutz und gewinnen etwas Boden unter den Füssen. Sie lernen mit Eifer die fremde Sprache und möchten dazu gehören. Gleichzeitig aber leben sie im Provisorium. Nicht nur wegen der lange dauernden Asylverfahren, sondern auch, weil sie die Sehnsucht nach der Rückkehr in ihre Heimat im Herzen tragen. So ist es nicht nur verständlich, sondern richtig, wenn sie unter sich ihre Muttersprache sprechen und ihre Kultur auch in der Fremde so gut als möglich zu pflegen versuchen.
Hilde Domin selbst sieht „das Paradox der Existenz … täglich am Flüchtling exemplifiziert“ (GAF 86). Und dennoch – ein Schlüsselwort für das Leben und das Werk der Dichterin – ist dies für sie kein Grund zur Verzweiflung.
Die jüdisch-christliche Tradition ist vertraut mit diesem Paradox. Die Kenntnis um die Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens lassen dieses als „vorläufig“ erscheinen. Sich selbst als „Gast auf Erden“ zu empfinden, kann frei machen für Gastfreundschaft anderen gegenüber. „Fremd“ und „heimisch“, „vorläufig“ und „auf Dauer“ – diese Begriffe können als Spannungspole im „Paradox der Existenz“ gesehen werden.
In den Poetikvorlesungen, die sie 1984 in Frankfurt hielt, spricht Domin über ihre Auseinandersetzung mit dem Mythos des Sisyphus. Wie Albert Camus, Hans Magnus Enzensberger und andere steckt für Domin in der unmenschlichen Strafe des traurigen Helden in der Unterwelt ebenfalls ein Paradox. Und wenn auch der Stein immer wieder vom Gipfel des Berges zurückrollt und Sisyphus von vorne beginnen muss, mühsam den Stein hochzurollen, er muss daran nicht verzweifeln. Sie liest den Mythos als „Aufforderung, das Unmögliche zu tun“ (GAF 89):
Sisyphus
Variationen auf einen Imperativ von Mallarmé
‚Die grossen blauen Löcher
die die Vögel machen die argen’
die schwarzen Risse der Nachrichten
frühmorgens
‚stopfe sie
mit unermüdlicher Hand’
Kämme die Berge
lösche
wische weg
die Kreuzfahrerheere
fahrend zu unheiligen Gräbern
die Löcher die die Kreuzfahrer machen die argen
stopfe sie
mit unermüdlicher Hand
Und Münder die rufen
mit unermüdlichem Atem
aufgestellt in allen Ländern
und riesige Herzen neue Totems
reibe sie mit Meersand ab
die siebenfältige Herzhaut die arge
Impfe
mit den Tränen der Gefolterten
uns Überlebende
uns Nachgeborene
Die Wege sind krank
Tritte der Kreuzfahrer unermüdliche
müssen geglättet werden
mit den Handflächen unermüdlichen
stopfe
die grossen blauen Löcher
die die Flugzeuge machen die argen
und die schwarzen Risse
halte
die Ränder der Wunden zusammen
stopfe die Haut des Planeten
es reisst in unserm Jahrhundert
stopfe
mit unermüdlicher
mit nie ermüdender Hand
rufe
mit nie ermüdendem Atem
die nie ermüdenden Hände
Bergaufwärts gerollt
die Steine
werden Quelle und Brot
(GG 346-347)
„Können wir ‚die Haut des Planeten‘ stopfen?“, fragt Hilde Domin selbst in ihrer Poetik-Vorlesung. (GAF 92)
Unermüdlich
Können wir die Flüchtlinge bei uns willkommen heissen? Können wir die Fluchtgründe aus der Welt schaffen? Können wir den Menschen als Menschen begegnen? Nicht umsonst heisst das Gedicht Sisyphus. „Versucht werden muss es, täglich und von jedem an seiner Stelle. … Verlier die Hoffnung nicht, dass du, an deiner Stelle, etwas ändern kannst.“ (GAF 92-93) Das ist der Appell der Dichterin. Von den Angerufenen erwartet sie, dass sie sich einsetzen gegen das Freund/Feind-Denken. Dass sie nicht müde werden, sondern mit ihrem Atem, der Sprache, rufen und mit ihren Händen, tatkräftig, die Löcher in der Haut des Planeten stopfen, und die Wunden an Körpern und Seelen. Sie erwartet, dass „so unmöglich es auch scheinen mag, der Mensch dem Menschen ein Helfer sei.“ (GAF 93)
Abkürzungen der verwendeten Literatur von Hilde Domin:
GA Gesammelte autobiografische Schriften. Fast ein Lebenslauf, Frankfurt a.M. 1998
GAF Das Gedicht als Augenblick von Freiheit. Frankfurter Poetik-Vorlesungen (1988), Frankfurt a.M. 1999
GE Gesammelte Essays. Heimat in der Sprache, Frankfurt a.M. 1993
GG Gesammelte Gedichte, Frankfurt a.M. 1999
—
Autorin: Franziska Loretan-Saladin
Bild von Hilde Domin: © Li Hangartner
- Vgl. Franziska Loretan-Saladin, Dass die Sprache stimmt. Eine homiletische Rezeption des dichtungstheoretischen Reflexionen von Hilde Domin, Freiburg Schweiz 2008 (= Praktische Theologie im Dialog, Band 32) ↩