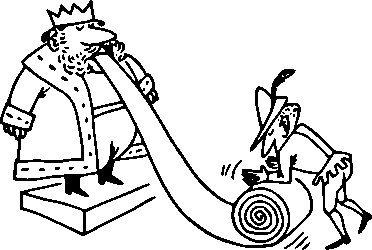Angesichts der Grundverunsicherungen v.a. für junge Menschen in der Coronapandemie fragt Mirjam Schambeck sf, was christliche Religion und Theologie in der Krise anbieten kann.
Erst kürzlich – es war beim Warten an einer Ampel – sah ich einen jungen Mann, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „spoiled youth“ trug. Verdorbene Jugendzeit. Immer öfter kommt mir dieses Gefühl von jungen Leuten entgegen, durch Corona um kostbare Lebenszeit betrogen zu werden. Die Möglichkeiten, sich mit Freund*innen zu treffen, sind durch die Kontaktbeschränkungen massiv reduziert. Nach dem Abitur ins Ausland zu gehen, neue Erfahrungen in anderen Ländern und Kulturen zu machen und Erwachsenwerden nochmals ganz anders zu erproben, werden durch die strengen Einreisebestimmungen zur mission impossible. Und selbst sonst reichlich vorhandene Praktikumsstellen stehen nicht wie vor Corona zur Verfügung. So beklemmend dies ist, es sind trotzdem Erfahrungen privilegierter, weil bildungsnaher junger Menschen, die Abitur gemacht haben oder gerade studieren.
Von Corona um wertvolle Lebenszeit betrogen.
Noch schwieriger ist es für Jugendliche aus sog. prekären Milieus. Ihnen fehlt nicht nur das Wünschenswerte, sondern das Lebensnotwendige. Wenn Schulen und öffentliche Freizeiteinrichtungen schließen, wenn Sozialarbeiter*innen, wie im Frühjahr 2020, anfangs nicht einmal digital zur Verfügung stehen, dann geht ihnen Support verloren, der überlebenswichtig ist. Insofern werfen die Ängste und Fragen, die Corona provoziert, auch ein Schlaglicht auf die in Deutschland polarisierte Sozialstruktur. Die Pandemie deckt auf, was schon lange gärt, und rückt unbarmherzig ins Blickfeld, welche auch überzogenen Entgrenzungen die Spätmoderne begleiten, die in ihren neoliberalistischen Zügen nicht wenige Menschen in Deutschland ins soziale Ghetto katapultiert haben.
Schlaglicht auf polarisierte Sozialstruktur.
Wenn die Coronapandemie nicht nur als eine Krise unter vielen einsortiert werden soll, sondern als Tipping Point genutzt wird, an dem Dynamisierungen, die nicht gerade zum guten Leben führen, zumindest aufgedeckt und, wer weiß, vielleicht sogar aufgehalten werden, dann steht uns ein Bündel an Aufgaben ins Haus. Es gilt, sich den Grundverunsicherungen zu stellen, die in der Coronapandemie gesellschaftlich und individuell-biographisch laut geworden sind, und danach zu fragen, was sie bedeuten und wie ihnen produktiv begegnet werden kann.
Tipping Point: Corona
Wie sieht es also aus? Wie geht es den Menschen? Was beschäftigt junge Leute, die anders als ältere Generationen solche massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch nicht erlebt haben, und einerseits zur schwächsten, weil wirtschaftlich abhängigen, gesellschaftlichen Gruppe gehören, andererseits aber zumindest prospektiv zur wirkmächtigsten, weil sie die Zukunft eines Landes sind? Und: Was kann (christliche) Religion und die Theologie mit ihr in dieser Krise anbieten?
Die durch die Pandemie aufgeworfenen Grundverunsicherungen, die im gesellschaftlichen Makrokosmos spürbar sind, haben sich tief in die Lebensgefühle Jugendlicher eingegraben. Allererste Befunde repräsentativer Jugendstudien zu Corona decken auf, dass junge Menschen Corona mit negativen Gefühlen wie Angst, Verunsicherung und Trauer assoziieren.1 Ähnlich oft sprechen Teenager (14 – 17 Jahre) davon, dass die Coronazeit für sie Langeweile bedeutet, Stress und Anspannung. Man fühlt sich sozial isoliert, die wirtschaftlichen Sorgen in der Familie bedrängen die jungen Leute, und was werden wird, ist ungewiss. Junge Menschen, die zu Hause auf eine sozial gehobene Lebenswelt zurückgreifen können, denken noch weiter und fürchten, dass die momentane Krise längerfristige negative Auswirkungen hat: wirtschaftlich gesehen, ökologisch und bzgl. des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Sie sorgen sich, dass durch die coronabedingte Unruhe die Demokratie gefährdet werde, ja sogar erodieren könnte.2
Grundunversicherungen haben sich tief in das Leben von Jugendlichen eingegraben.
Auch wenn diese Angst um den gesellschaftlichen Zusammenhalt eher ein Empfinden weniger, und wenn, dann privilegierter junger Menschen ist, lässt sie ahnen, dass die durch Corona ausgelösten Veränderungen nicht nur akute, sondern grundsätzlichere Fragen aufwerfen nach dem, was uns gesellschaftlich zusammenhält und individuell-biographisch stärkt. Sog. bildungsferne Jugendliche geben sich hier robuster und sehen sich v. a. durch die Einschränkungen der persönlichen Freiheiten genervt.3 Dass Jugendtreffs, Sportvereine und andere öffentliche Treffpunkte im Frühjahr ganz geschlossen wurden und auch jetzt im Lockdown light (November 2020) höchstens mit reduzierten Kapazitäten arbeiten, betrifft sie besonders hart. Ihnen stehen zu Hause keine komfortablen Wohnungen zur Verfügung stehen, so dass deren Benachteiligung durch den verunmöglichten Zugang zu öffentlichen Räumen nochmals verschärft wird.
Auch wenn sich viele Jugendliche nicht selbst als gesundheitlich gefährdet sehen, haben sie Angst um ihre Familienangehörigen, um Oma und Opa. 60 % der in der aktuellen Sinus-Jugendstudie befragten Jugendlichen geht es so.4 Noch auffälliger ist, dass sie zwar nicht um ihre eigene Gesundheit fürchten, aber Angst haben, andere anzustecken und damit an deren Schicksal schuld zu sein. Insgesamt bedrängen junge Leute die Sorgen um die Zukunft, wie es weitergehen kann, was sie erwartet und dann auch die wirtschaftliche und finanzielle Lage ihrer Familien am meisten. Was aber bedeuten diese Grundverunsicherungen und Ängste nicht nur der jungen Menschen, aber eben auch dieser? Wie gehen sie und wir gesellschaftlich damit um? Welche Hilfen machen wir uns zunutze? Wo holen wir uns Orientierung?
Angst um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Im Grunde wirft Corona zutiefst religiöse Fragen auf: Die Pandemie zeigt uns, dass unser Leben nicht glatt läuft, so sehr wir es auch perfektioniert haben. Ein Virus, das nicht einmal sichtbar ist, setzt unsere Routinen außer Kraft und hebt eine ganze Welt aus den Angeln. Es führt uns unmissverständlich vor Augen, dass wir sterblich sind, verletzlich, von jetzt auf gleich unseren Alltag umstellen müssen und hinzunehmen haben, dass unsere selbstverständlich gewordenen Kraftorte – ob die Treffen mit Freund*innen, der Gruppensport oder auch nur der Restaurantbesuch – so nicht mehr möglich ist. Der erfahrene Kontrollverlust wirft existentielle Fragen auf und lässt nach verlässlichen Sicherheiten in dieser außergewöhnlichen Situation fragen, die mit den gewohnten Mitteln nicht beherrschbar ist. Dort, wo es um die Existenz geht, um das Eingemachte und Letzte, dort geht es auch um Religion. Die Frage aber ist, taugt Religion noch für Krisen? Nutzen Menschen die Ressource Religion, um mit den Ängsten, die Corona auslöst, besser zurecht zu kommen und sich durch die Sorgen nicht ersticken zu lassen?
Corona wirft religiöse Fragen auf.
Bislang gibt es dazu eher unterschiedliche Eindrücke: Als die Kirchen besonders nötig gewesen waren, sind sie in die Versenkung abgetaucht. Ja man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man in manchen Bistumsleitungen und Pfarrhäusern froh war, endlich ein vorzeigbares Alibi aufweisen zu können, um von der Bildfläche zu verschwinden. Gottesdienste wurden auch dort abgesagt, wo die Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Internetübertragungen transportierten die Leere und Ratlosigkeiten der Kirchen in Form klerikalisierter und sterilisierter Gottesdienste sinnenfällig in die Wohnzimmer. Und auch als sich Philosoph*innen und Soziolog*innen längst schon um Deutungen mühten, wie wir mit den existentiellen Fragen, die die Pandemie aufwirft, umgehen können, haben wir Theolog*innen uns eher noch zögerlich eingemischt. Das ist die eine Seite: Die Ressource Religion fehlte und fehlt in den öffentlichen Debatten, auch weil Religionsvertreter*innen und Theolog*innen in der Öffentlichkeit – und d. h. weitgehend medial – wenig vernehmbar waren.
Die Ressource Religion fehlte und fehlt.
Die andere Seite ist versteckter, aber sie war da und wirkt noch immer: Da gab es pastorale Mitarbeiter*innen, Gemeindemitglieder und zivilgesellschaftlich Engagierte, die mitmachten, manchmal bis zur Erschöpfung arbeiteten, und kreative Formate entwickelten, um Solidarität zu üben und Hilfe anzubieten: ob dies Gottesdienste „to go“ waren oder diakonische Angebote, um Isolierten in ihrer Vereinsamung beizustehen, sie durch Einkaufsdienste, Care-Pakete oder musikalische Events auf der Straße vor dem Altenheim zu unterstützen. Die Pandemie hat ein diakonisches Gesicht von Kirche (und in unserer Gesellschaft) gezeigt und ein solidarisches, das es verdient, auch in der Öffentlichkeit deutlicher wahrgenommen zu werden – nicht nur, weil die Kirche damit besser dasteht, sondern weil das Diakonische und Solidarische in unserer Gesellschaft etwas einzubringen hat, das dem Höher – Schneller – Weiter eine lebensdienlichere Lebensmaxime entgegenstellt.
Dass beide Seiten bislang so kläglich auseinanderklaffen – die öffentliche, mediale Vernehmbarkeit und das diakonische und solidarische Engagement –, ist nicht einfach nur schade; es beraubt der Öffentlichkeit und damit den Menschen, für die die Kirche da ist, der Möglichkeit, sich überhaupt die Frage zu stellen, ob sie auf die Ressource Religion zurückgreifen wollen. Die Mammutaufgabe stellt sich also, wie diese Stimme des Diakonischen und Solidarischen deutlicher zu Gehör gebracht werden und die Ressource Religion als Inspiratorin eines gelingenden Lebens auch in Krisenzeiten zumindest als Deuteangebot zur Verfügung stehen kann, um den Grundverunsicherungen, die die Pandemie ausgelöst hat, nicht gnadenlos ausgeliefert zu bleiben. Hier schlägt die Stunde der Theologie, hier gibt es viel aufzuarbeiten, aber auch anzubieten.
___
Text: Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf, Lehrstuhl für Religionspädagogik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Freiburg.
Bild: Elisabeth Wöhrle sf