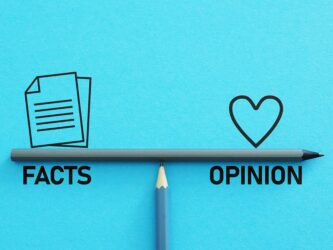Ohne Geld kein gutes Wirtschaften in dieser Welt – wenn das so ist, braucht es ein funktionales Finanzsystem. Und eine Finanzmarktethik, die sich ohne Scheuklappen darum sorgt. Noemi Honegger skizziert die Herausforderung anhand der Credit- Suisse-Rettung.
Mitte März 2023 bewegte die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS die Schweiz. Die zweite Rettungsaktion einer Schweizer Großbank unter Anwendung von Notrecht innerhalb von nur fünfzehn Jahren löste in der Bevölkerung Empörung und Unverständnis aus. Durch jahrelange Misswirtschaft und zahlreiche Skandale hatte die Credit Suisse das Vertrauen ihrer Kund*innen verspielt. Diese zogen ihre Gelder ab. Einmal mehr zeigte sich, dass Vertrauen eine der wichtigsten Währungen eines Bankensystems ist. Das System funktioniert nur, wenn Wirtschaftsakteure darauf vertrauen, dass Banken über genügend Liquidität verfügen, um Zahlungsversprechen jederzeit einzulösen. Ist dieses Grundvertrauen erst einmal verspielt, wird eine Abwärtsbewegung in Gang gesetzt, die Banken unaufhaltsam unter Druck setzt. Nach und nach werden ihnen die liquiden Mittel und damit ihre Existenzgrundlage entzogen.[1]
Banken tun deshalb gut daran, dieses Vertrauen zu pflegen und es nicht leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. Der Credit Suisse ist das in den letzten Jahren nicht mehr gelungen, was schließlich zu ihrem Ende führte.[2] Nur durch die staatlich herbeigeführte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS konnte der Konkurs vermieden werden. Der Umgang mit dem Untergang der Credit Suisse stellt damit die 2012 in Kraft getretenen «Too big to fail»-Regulierung offen in Frage. Diese hatte zum Ziel, die Abwicklung einer Schweizer Großbank im Krisenfall zu ermöglichen. Aus der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist eine noch größere Bank hervorgegangen. Die «too big to fail»-Problematik hat sich dadurch markant verschärft. Umso dringender müssen effektive Lösungsansätze erarbeitet und umgesetzt werden, denn ohne eine im Krisenfall umsetzbare «too big to fail»-Regulierung handelt man sich verschiedene Probleme ein, die aus sozialethischer Sicht nicht zu verantworten sind.
Keine Bank ist zu groß fürs Scheitern…
Diese Regulierung wurde nach der Bankenkrise 2008 entwickelt. Ziel war es, systemrelevante[3] Banken durch höhere Kapital- und Liquiditätsanforderungen widerstandsfähiger auszugestalten und vor allem ihre Abwicklungsfähigkeit zu stärken. Mit anderen Worten ging es darum, dass keine Bank als «too big to fail» gilt und bei Schwierigkeiten durch den Staat gerettet werden muss. Kernbestandteil der Regulierung ist unter anderem, dass systemrelevante Geschäftsbereiche abgespaltet werden können und der Rest saniert oder abgewickelt wird.[4] Für die Credit Suisse hätte das konkret bedeutet, das Schweizer Geschäft abzuspalten wie auch erfolgreich weiterzuführen – und die übrigen Geschäftsbereiche abzuwickeln. In den turbulenten Tagen im März 2023 wurde entschieden, diese Regulierung nicht auf die Credit Suisse anzuwenden – obwohl sie doch gerade für einen solchen Fall ausgearbeitet worden war. Die Schweizer Regierung war im Gegenteil dazu bereit, die Fusion mit der UBS aktiv herbeizuführen und finanzkräftig abzusichern. Die Gefahr einer internationalen Finanzkrise, die auch dem Standort Schweiz geschadet hätte, wurde als zu groß erachtet. Ebenso schien das Vertrauen in die Credit Suisse insgesamt so stark angeschlagen, dass eine Weiterführung des Schweizer Geschäfts als zu risikoreich beurteilt wurde.
Die Büchse der Pandora wieder schließen – um Fehlanreize zu vermeiden!
Obwohl die Entscheidungsträger*innen im ersten sich bietenden Ernstfall nicht wagten, die «too-big-to-fail»-Regulierung anzuwenden, spricht aus sozialethischer Sicht vieles dafür, an den Regulierungsbemühungen festzuhalten und aus dem Fall der Credit Suisse Lehren für die Zukunft zu ziehen. Die «too-big-to-fail»-Regulierung über Bord zu werfen, würde nichts anderes bedeuten, als dass der Schweizer Staat Großbanken die Unterstützung im Krisenfall de facto zusagt. Diese Staatsgarantie und das Wissen um eine mögliche oder viel mehr notgedrungene staatliche Rettungsaktion im Fall einer Krise führen zu Verzerrungen und setzen Fehlanreize.[5] Banken werden sich dadurch in Sicherheit wiegen und grössere, unnötige und potenziell schädliche Risiken eingehen. Gleichzeitig müssen sie im Fall von unternehmerischem Misserfolg oder gar Misswirtschaft keine Konsequenzen in Form eines Konkurses fürchten. Banken, die systemrelevant sind und deshalb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch den Staat gerettet würden, verletzen nicht nur grundlegende Spielregeln einer freien Marktwirtschaft, sondern bringen sozialethisch relevante Herausforderungen mit sich.
Akteurinnen für einen Umgang mit befristeter Zeit – die sozialethische Wertigkeit von Banken
Zunächst ist es zentral, dass Banken ihren Kerngeschäften erfolgreich nachgehen, denn darin liegen ihre relevanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leistungen. Diese können in einfach Worten umrissen werden: Banken ermöglichen überhaupt erst unseren Zahlungsverkehr, der ein wesentliches Erfordernis eines funktionalen Wirtschaftssystems ist. Dabei gewinnen insbesondere bargeldlose Zahlungsformen, die auf sogenanntem Giralgeld – auf elektronischem Buchgeld – basieren, an Bedeutung. Weiter lassen sich mittels Bankkonten Ersparnisse bilden. Geld kann damit für die Zukunft aufbewahrt und durch Zinserträge vermehrt werden. Diese entstehen, indem Banken den einen die Ersparnisse der anderen in Form von Krediten zur Verfügung stellen. Dadurch werden Investitionen ermöglicht und Innovationen gefördert. Ökonomisch gesprochen sind Banken sogenannte Finanzintermediäre, die die Aufgabe der Fristentransformation wahrnehmen: Während Schuldner*innen die erhaltenen Kredite in der Regel langfristig investieren, wollen Sparer*innen jederzeit auf ihre Ersparnisse zugreifen können. Banken gelingt es, zwischen diesen beiden Gruppen und ihren unterschiedlichen Zeithorizonten zu vermitteln. Über die Funktion der Fristentransformation hinaus schöpfen Banken im Prozess der Kreditvergabe neues Geld und halten damit das Wirtschaftssystem als Ganzes am Laufen.[6]
Banken am Finanzmarkt: Eigenkapitalvorschriften sind notwendig
In Kontinentaleuropa beruhte das Finanzierungssystem während vieler Jahrzehnte auf der Kreditvergabe durch Geschäftsbanken. Erst ab den 1970er-Jahren wurden marktbasierte Finanzierungsmodelle mit verbrieften Wertpapieren – die ursprünglich und unter Bedingungen eines strikten Trennbankensystems im angelsächsischen Raum beheimatet waren – populär. Diese Öffnung hin zum Markt bot Geschäftsbanken lukrative Geschäftsmöglichkeiten im Bereich des Investementbankings, die sie zum einen rege nutzten. Zum anderen wurden sie dadurch den Risiken der Finanzmärkte ausgesetzt. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war die Finanzkrise 2007/2008, in der viele Banken strauchelten oder gar zu Fall kamen.[7] Angesichts der Marktorientierung dürfen implizite staatliche Garantien nicht dazu führen, dass Geschäftsbanken ihr Kerngeschäft zugunsten von risikoreichen, wenn auch zeitweise lukrativen Geschäften vernachlässigen. Im Gegenteil, Regulierungen müssten dazu führen, dass Banken in unternehmerischer Freiheit ihre Funktion bestmöglich erfüllen und gesellschaftlich relevante Leistungen erbringen. Gleichzeitig müssen sie die Risiken, die sie eingehen, konsequent selbst tragen können. Ein Ansatz dazu bieten bereits heute die Eigenkapitalvorschriften. Risikoreiche Geschäfte müssen mit einer höheren Eigenkapitalquote unterlegt sein als risikoarme.[8] Denn Eigenkapital in ausreichender Höhe verhindert, dass die steuerzahlende Bevölkerung Risiken ausgesetzt wird, die sie selbst nicht verschuldet haben.
Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Verlusten?
Riskante Finanzgeschäfte generieren unter Umständen über einen gewissen Zeitraum hinweg große Gewinne. Von diesen profitieren die Finanzinstitute, ihre Eigentümer*innen als auch ihre Kund*innen. Im Fall eines Bail-Outs, einer staatlichen Rettungsaktion, werden die Risiken und spätere Verluste hingegen auf die Allgemeinheit übertragen. Während Gewinne privat gutgeschrieben werden, werden übergroße Risiken und Verluste sozialisiert. Diese Asymmetrien sind aus ethischer Perspektive aber anstößig. Mit Blick auf die entstandene Großbank kommen auf den Finanzplatz Schweiz Herausforderungen zu, die besser heute als morgen angegangen werden. Die «too big to fail»-Regulierung muss deshalb zwingend weiterentwickelt werden, damit sie in kommenden Krisensituationen ohne Vorbehalte angewendet werden kann.
[1] Diese Zusammenhänge gelten nicht nur für den Fall der Credit Suisse, sondern in je unterschiedlicher Weise auch für Finanzkrisen von 1929 und 2008. Während die Finanzkrise 1929 dadurch befeuert wurde, dass Bankkund*innen ihre Ersparnisse von ihren Konten abzogen – es also zu einem klassischen bankrun kam – trocknete die Liquidität der Banken zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch andere Mechanismen aus: Geschäftsbanken hatten sich an hochriskanten Geschäften beteiligt und vertrauten sich nicht mehr. In der Folge liehen sich gegenseitig kein Geld mehr. Eine Einführung in die Finanzkrise findet sich bei Brunetti, Aymo, Wirtschaftskrise ohne Ende? : US-Immobilienkrise, globale Finanzkrise, europäische Schuldenkrise, 3. Aufl. ed. (Bern: hep-Verlag, 2012).
[2] Die Berichterstattung über die Hintergründe des Untergangs der Credit Suisse waren vielfältig. Ein instruktiver Artikel erschien zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Online verfügbar unter: https://www.nzz.ch/gesellschaft/credit-suisse-so-verspielte-die-cs-das-vertrauen-ld.1731353?reduced=true (Letzter Zugriff 17.10.2023).
[3] Die Schweizer Finanzmarkt Aufsicht (Finma) definiert systemrelevante Banken als Banken deren Ausfall die Schweizer Volkswirtschaft und das schweizerische Finanzsystem erheblich schädigen würde. Vgl. https://www.finma.ch/de/durchsetzung/resolution/too-big-to-fail-und-systemstabilitaet/systemrelevante-banken/ (Letzter Zugriff 17.10.2023).
[4] Vgl. https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/finanzplatz/uebernahme-credit-suisse-ubs/tbtf-regulierung.html (Letzter Zugriff 17.10.2023).
[5] Vgl. Christophers, Brett, Rentier Capitalism. Who Own the Economy and Who Pays for It? (London, New York: Verso, 2020), 60.
[6] Zu der Geldschöpfung durch Geschäftsbanken siehe zum Beispiel Binswanger, Mathias, Geld aus dem Nichts : Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen verursachen, 1. Aufl. ed. (Weinheim: Wiley, 2015).
[7] Zu der Rolle der Geschäftsbanken in der Finanzkrise siehe Brunetti, Wirtschaftskrise ohne Ende? : US-Immobilienkrise, globale Finanzkrise, europäische Schuldenkrise.
[8] Entsprechende Vorschriften sind insbesondere im finanzregulatorischen Abkommen «Basel III» festgehalten. Vgl. https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm (Letzter Zugriff 17.10.2023).
—

Noemi Honegger ist Theologin und Volkswirtin und als Diplom-Assistentin am Lehrstuhl für Moraltheologie und Ethik an der Universtität Fribourg tätig. In Ihrer Dissertation befasst sie sich mit Fragen zum Verhältnis von Finanz- und Realwirtschaft.
Bild: Lupo – pixelio