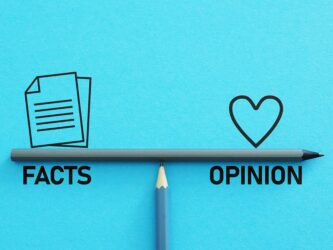Viele Filme der diesjährigen Berlinale hatten Bezüge zu kirchlichen und theologischen Fragen. Ein Rückblick auf das Festival von Dietmar Adler.
Am vorletzten Berlinale-Morgen verbreitet sich die Nachricht vom Tode von Bruno Ganz. Er war Engel und Faust, er war Suchender und Agierender. Er spürte sich in seine Rollen hinein, und ließ die Zuschauenden das Innere sehen, hören, spüren.
Bei der Verleihung der Preise der Unabhängigen Jurys erinnert Festivaldirektor Dieter Kosslick an den großen Schauspieler, der auch der Berlinale mit vielen Filmen verbunden war. Warum der Himmel an diesem Morgen so wolkenlos sei – damit es für Bruno Ganz keine Hindernisse auf seinem Weg in den „Himmel über Berlin“ gebe, so Kosslick.
Bruno Ganz war Engel und Faust, Suchender und Agierender.
Und auch viele Filme der diesjährigen Berlinale hatten implizite oder gar explizite Bezüge zu kirchlichen und theologischen Fragen.
God exists – her name is Petrunya – Der Film der mazedonischen Regisseurin Teona Strugar Mitevska gewann den Preis der Ökumenischen Jury.
Die von SIGNIS und INTERFILM nominierte und aus Uganda, Kanada, USA und Deutschland zusammengekommene Jury war sich einig: Der aus Mazedonien (seit dieser Woche „Nord-Mazedonien“) stammende Film ist eine „wagemutige Schilderung der Verwandlung einer machtlosen jungen Frau in eine entschiedene Verteidigerin der Frauenrechte“.
Verwandlung einer machtlosen jungen Frau in eine entschiedene Verteidigerin der Frauenrechte
Petrunya, eine junge Frau aus Mazedonien, springt ebenfalls in den Fluss, als der orthodoxe Priester das Kreuz ins Wasser wirft und Horden junger Männer hinterher springen, um sich das Kreuz herauszufischen. Wer es bekommt, wird Glück haben. Was Petrunya so alles erlebt, als sie es ist, die sich das Kreuz sichert, zeigt der Film. Die Männer-Welt ist verunsichert, reagiert mit Aggression. Petrunya wird angegriffen, muss fliehen, wird schließlich in Polizeigewahrsam genommen, nur weil sie sich das gleiche Recht genommen hat wie die Männer. Petrunya bricht in eine Männerdomäne ein und erntet Zorn. Aber Petrunya kann das Kreuz verteidigen, sie spürt in sich eine Kraft.

Fein beobachtet der Film aber auch die Risse zwischen der Kirche und „dem Kirchenvolk“. Schon zu Beginn reagieren die Männer, die darauf warten in den Fluss zu springen, mit Ungeduld angesichts der Worte und Riten des Priesters, bevor er das Kreuz wirft. Und auch später wird der Priester durchaus differenziert gezeichnet.
Die Regisseurin wurde bei der Preisverleihung von ihrer Schwester, der Mit-Produzentin und Darstellerin Labina Mitevska vertreten. Die Ökumenischen Preise habe sie stets sehr geschätzt, weil in diesen Filmen in besonderer Weise Fragen nach einer besseren Welt behandelt werden. Nun zu diesem „Club“ der Ökumenischen Preisträger zu gehören, sei „amazing“. Ihre Rede schloss mit dem Ausruf: „Die Zukunft ist weiblich!“
Kirchenkritik – hart, aber in der Regel nicht ungerecht
Kirchenkritik – die gibt es etlichen Filmen der Berlinale. Sie fällt hart aus, aber in der Regel nicht ungerecht. Da werden Motive und Personen differenziert gezeichnet.
Grâce à Dieu – Gelobt sei Gott. François Ozon nimmt sich des Skandals der Vertuschung sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester im Erzbistum Lyon an. Der Fokus des Films richtet sich nacheinander auf drei Männer, die als Kinder von einem Priester missbraucht wurden und sich nun zusammenschließen.
Drei Männer, als Kinder von einem Priester missbraucht
Da ist Alexandre, Vorzeigefamilie, gut katholisch, beruflich erfolgreich. Durch Zufall entdeckt er, dass der Priester, der ihn Jahrzehnte zuvor missbrauchte, immer noch Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat. So beschließt er, der Sache nachzugehen und entdeckt, dass die Zusicherungen der Kirche nicht eingehalten wurden. Immer mehr wird Kardinal Barbarin zu Alexandres Gegenüber. Alexandres Motiv: Er möchte den Skandal aufdecken, um der Kirche zu helfen. Er ist und bleibt – trotz aller Zweifel – gläubig. Bei der Suche nach weiteren Opfern des gleichen Priesters lernt Alexandre François kennen. Er ist Atheist und wird zum Aktivisten gegen die katholische Kirche. Der dritte Protagonist ist Emmanuel. Der Missbrauch als Kind hat sein Leben durchkreuzt, er ist gesundheitlich angeschlagen, eine prekäre Existenz.
Sowohl der Täter als auch der Kardinal erscheinen durchaus differenziert.
Der Film mutet dokumentarisch an. Ozon selbst erklärt auf der Pressekonferenz, dass er manches von den Lyoner Ereignissen hätte gar nicht darstellen können, er habe es darum neu erfinden müssen. Bemerkenswert ist, dass sowohl der Täter als auch der Kardinal durchaus differenziert erscheinen. Mittendrin die skandalöse Aussage Barbarins, die dem Film den Titel gibt: Gott sei Dank seien die meisten Taten verjährt.
Der Prozess gegen Kardinal Barbarin wegen Vertuschung der Vorfälle wird derzeit geführt, ein Urteil wird im März 2019 erwartet, teilt uns der Film im Abspann mit.
Kann jemand, der Missbrauch und Vertuschung erlebt hat, noch an Gott glauben?
Der Film stellt nicht nur die Frage nach einem sachgemäßen Umgang der katholischen Kirche mit Opfern und Tätern. Noch existentieller ist die Frage, ob jemand, der Missbrauch und Vertuschung erlebt hat, überhaupt noch an Gott glauben kann. Eine Frage, die insbesondere in katholischen Kontexten Brisanz hat.
Übrigens: Bei der Preisverleihung für den Großen Preis der Jury dankt François Ozon nicht etwa dem Festival oder der Jury, sondern Gott.
Hin und Her der Gefühle
Geprägt war die Berlinale von ein Hin und Her der Gefühle. Kaum ein Film, der einhellig positive oder negative Kritik bekam.
Aufreger war sicher Fatih Akins Der Goldene Handschuh. Akin rekonstruiert darin die Taten Fritz Honkas. Dieser hatte in den 1970er Jahren in Hamburg mindestens vier Frauen in seine Wohnung gelockt und sie bestialisch ermordet. Honka wurde zum Schreckgespenst dieser Zeit.
Aufreger
Der Film mutet den Zuschauenden viel zu, für manche zu viel. Er zeigt uns eine Welt von heruntergekommenen und verwahrlosten Menschen in der St.-Pauli-Kneipe „Der Goldene Handschuh“: Menschen, die keiner vermisst, wenn sie plötzlich verschwunden sind. Und er zeigt uns, wie Honka diese zumeist älteren Frauen in seiner engen Dachgeschosswohnung missbrauchte, sie tötete und anschließend die Körper zerkleinerte und die Leichenteile versteckte. Honka holt die Säge. Der Vorgang des Sägens ist nicht zu sehen, das Geräusch ist schrecklich genug.
Die Reaktionen des Publikums sind gemischt.
Zuviel Harmonie?
Auf der anderen Seite gab es den Eröffnungsfilm, dem viele wiederum zu viel Harmonie vorwarfen: In The Kindness of Strangers begleitet die dänische Regisseurin Lone Scherfig die junge Mutter Clara und ihre zwei Söhne durch ein unwirtliches New York. Sie sind vor dem gewalttätigen Familienvater geflohen. Für die Jungs ist es anfangs eine Urlaubsreise, aber die Lage der drei wird immer schwieriger. Clara muss für ihre Familie Essen klauen. Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die drei begegnen hier und dort Personen, die ihnen helfen, auch wenn sie selbst nicht auf der Sonnenseite leben: eine Krankenschwester, die in ihrer Freizeit in kirchlichen Räumen Selbsthilfegruppen anbietet, ein Anwalt, der nicht damit zurecht kommt, dass die wahren Bösewichte unbehelligt bleiben, einer, dem kein Job gelingt.
Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
Es sind selbst vom Leben gezeichnete Menschen, die eine tiefe Humanität ausstrahlen.
Manchen Kritikern war dieser Film zu sehr vom Glauben an das Gute im Menschen geprägt. Für andere war er – trotz vieler Geigen-Töne – ein wunderbares Portrait von Menschen am Rande. Es gibt Hoffnung – immer wieder.
Suche nach einer neuen Identität
Den Goldenen Bären erhielt der durchaus umstrittene Film Synonymes des israelisch Filmemachers Nadav Lapid. Der Film erzählt mit einer nervösen Kamerasprache die Geschichte eines jungen Israeli, der nach dem Wehrdienst in Paris ein neues Leben anfangen will. Schon in der ersten Nacht in der neuen Stadt wird er all seiner Sachen beraubt und steht buchstäblich nackt da. Alles, was ihn an Israel erinnert, möchte er hinter sich lassen, er sucht eine neue Identität. Der Film basiert auf eigenen Erfahrungen des Regisseurs.
Eine um ihren verstorbenen Partner trauernde Frau
Ebenfalls von eigenen Erfahrungen bewegt ist die Gewinnerin des Silbernen Bären Angela Schanalec mit ihrem Film Ich war zuhause, aber. Die der Berliner Schule zugerechnete Regisseurin zeigt darin eine um ihren verstorbenen Partner trauernde Frau, die um sich selbst kreist und die nicht mehr angemessen mit ihren Kindern umzugehen vermag. Schülerinnen und Schüler, die Hamlet rezitieren, die Rückabwicklung eines Fahrradkaufs und Auseinandersetzungen um künstlerische Positionen stehen daneben, korrespondieren oder eben nicht.
Es fällt auf, dass die Bären-Jury mit den Filmen von Lapid und Schanalec insbesondere solche sehr subjektiven und artifiziellen Filme ausgezeichnet hat. Da wird künstlerisch Position bezogen, das bleibt naturgemäß heftig umstritten.
Ein Kind, das Liebe sucht.
Mit dem Alfred-Bauer-Preis wurde der deutsche Film Systemsprenger. Als Systemsprenger gelten Kinder, die durch ihre immer wieder aufbrechende Gewaltbereitschaft in keinem System heimisch werden können. Die 9-jährige Benni hat schon so manch eine Jugendhilfeeinrichtung „durch“. In der Schule verletzt sie eine Mitschülerin mutwillig, beim Eislaufen drischt sie auf ihren Pflegebruder in der Ersatzfamilie ein. Die Erzieher sind ratlos, die Mitarbeiterin des Jugendamtes ist verzweifelt: Wo kann Benni noch leben, welche Umgebung kann stabilisierend auf sie wirken? Ihre Mutter ist überfordert. Alle wissen: Benni braucht Bindung, braucht Menschen, die sich auf sie einlassen. Das können professionelle Helfer bei allem guten Willen und toller Professionalität nur bis zu einer bestimmten Grenze bieten. In ihrem fulminanten Spielfilmdebut zeigt die Regisseurin Nora Fingscheidt ein Kind, das Liebe sucht; Betreuung reicht ihr nicht. Mit grellen Farben und kraftvoller Musik und vor allem einer großartigen Hauptdarstellerin (Helena Zengel) hinterlässt der Film Eindruck und mit ihm Benni und all die anderen Kinder, die als Systemsprenger gelten.
Wie politisch das Private und wie privat das Politische ist.
Mit zwei Silbernen Bären wurden die Hauptdarsteller des chinesischen Films So long, my son von Wang Xiaoshuai ausgezeichnet. Als einer der wenigen Filme wird er von Publikum und Kritik begeistert aufgenommen. Der Film zeigt eindrücklich und großartig montiert, wie politisch das Private und wie privat das Politische ist – das Thema der Berlinale. Über 30 Jahre wird eine Familie gezeigt. Der Tod des Sohnes verändert alles, ein zweites Kind war dem Paar durch die Einkindpolitik verwehrt. Existentielles und Politisches sind aufeinander bezogen. Die Veränderungen der chinesischen Gesellschaft werden im Leben dieser Familie sichtbar. Letztlich stellt dieser Film aber auch die Frage, woran du dein Herz hängst.
___
Dietmar Adler, Studium der Evangelischen Theologie in Münster und Tübingen, Pastor in Bad Münder (Niedersachsen). Mitbegründer und Sprecher des Arbeitskreises „Kirche und Film“ der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Seit 2019 Jury Coordinator der ökumenischen Filmorganisation INTERFILM.
Beitragsbild von Diana Rasch:
Labina Mitevska, die Schwester der Regisseurin Teona Strugar Mitevska, Mitproduzentin und auch Darstellerin in „God exists, her name is Petrunya“ – Preisträger der Ökumenischen Jury im Wettbewerb der Berlinale.