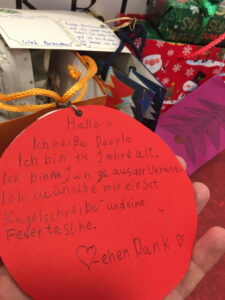Seit Mitte März ist das Gemeindehaus der Markuskirche Notunterkunft. Pfarrerin Carolin Marie Goepfert teilt einige der Geschichten.
Als der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann, wollten auch die Menschen aus unserer Gemeinde helfen. Zunächst wussten wir nicht, was wir beitragen können, während andere schon Hilfstransporte organisierten und Spendenakquise betrieben. Wegen der kalten Nächte wurden die Kirchengemeinden nach Übernachtungsmöglichkeiten angefragt. Unser Gemeindehaus ist sehr groß, und so entschieden wir: Wir richten eine Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete ein. Gesagt, getan. Seit Mitte März 2022 sind mehrere Hundert Gäste in unser Haus gekommen, wurden hier versorgt, konnten übernachten, essen, Kleidung bekommen, Wäsche waschen, sich in aller Ungewissheit und Fremdheit neu orientieren. Unsere jüngsten Gäste waren wenige Wochen alt, die Ältesten über 90. Einige blieben eine Nacht, andere mehrere Monate. So viele unterschiedliche Begegnungen, Geschichten und Gefühle an einem Ort prägten die vergangenen Monate für mich. Hier ein paar Bruchstücke aus dieser Zeit.
Unsere jüngsten Gäste waren wenige Wochen alt, die Ältesten über 90. Einige blieben eine Nacht, andere mehrere Monate.
Das Kind steht auf der engen Rampe und schreit. Ich weiß, er ist eines von acht Kindern, die zusammen mit ihrer Mutter bei uns in der Notunterkunft sind. Bisher habe ich ihn nur im Vorbeirennen gesehen. Meist mit einem Joghurtbecher in der Hand durch die Kleiderkammer im Foyer rennen. Jetzt steht er da mitten im Weg. Versteift durch Wut und Trauer. Eine Freiwillige steht neben ihm, versucht ihn zu beruhigen. Es hilft alles nichts, er schreit weiter. Als sie sieht, dass ich komme, geht sie. Seine Geschwister rennen um ihn herum. Laufen dann weg. Wahrscheinlich wollen sie die Mutter holen. Ich setze mich zu ihm. Mitten auf die Rampe, fange an zu malen. Erst schreit er weiter, guckt dann aber neugierig. Mit jeder Sekunde wird er leiser. Kommt zur Ruhe. Irgendwann setzt er sich auch hin. Malt mit. Seine Geschwister sind wieder da. Ohne die Mama. Sie malen nun auch mit. Wir alle sitzen im Weg. Von dem Tag an grüßen wir uns. Der Dreijährige und ich. Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, und doch irgendwie schon.
Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, und doch irgendwie schon.
Sie fängt sofort an zu sprechen: „Wisst ihr, wer bei euch im Garten wohnt?“ Sie spricht fließend Englisch. (Daher weiß ich, was sie sagt.) Mit hartem Akzent. Sie ist Englischlehrerin. „Ein Fuchs.“ Wir sprechen darüber, wie seltsam das ist – und gleichzeitig in Berlin ganz normal, und dass neben dem Rolltor an unserem Gemeindehaus sogar extra eine „Fuchsröhre“ eingebaut wurde. Sie erzählt, wie sie neulich mit Mann und Sohn in Steglitz spazieren war und wie ihnen dabei ein Fuchs über den Weg lief. Sie macht Scherze und sagt: „Erst ein Fuchs, dann ein Bär, und vielleicht noch eine Giraffe.“ Wir lachen. Auf einmal stockt sie. Schaut mich direkt an. „Weißt du, gestern konnte ich nicht aufhören zu weinen. Ich habe gelesen, dass die Tiere im Zoo von Charkiw eingeschläfert wurden, um ihnen weiteres Leid zu ersparen.“ Ich sehe sie an. Unsere Blicke treffen sich. Ich bekomme eine kurze Ahnung von dem Leid, der Verzweiflung und der Wut, die sie bei sich trägt. Ihr Telefon klingelt. Sie winkt, während sie schon telefoniert. Und ich begreife: Unbeschwertheit und Verzweiflung sind in diesem Haus wie Bruder und Schwester.
„Weißt du, gestern konnte ich nicht aufhören zu weinen. Ich habe gelesen, dass die Tiere im Zoo von Charkiw eingeschläfert wurden.“
Sie schaut ihr staunend hinterher – dieser Frau mit langem Pelzmantel, weiß-blonden Haaren (vorne kurz, hinten lang), hochhackigen Schuhen und einem goldenen, weit ausgeschnittenen Kleid. Ich schaue meine kleine, staunende Tochter an und sage: „Du findest sie sehr schön.“ Verträumt nickt sie. Sie ist schön, auf ihre Weise, wie wir alle auf unsere. In ihrem Gesicht sehe ich Trauer, Schmerz und Gram. Ich frage mich, was sie alles erlebt hat. Wenn sie läuft, wirkt jeder Schritt beschwert. So als laste ein Joch auf ihr. In der Unterkunft ist sie eine Einzelgängerin. Die anderen meiden sie. Mich rührt sie an und macht mich traurig. Ich sehe so viel von ihrer Würde, und ahne, was zerbrochen ist. Wenn sie gefragt wird, was sie braucht, sagt sie immer: Einen Ort, wo ich bleiben kann. Und wir suchen danach. Solange bleibt sie. Und wir staunen über sie, diese besondere Frau.
Ich sehe so viel von ihrer Würde, und ahne, was zerbrochen ist. Wenn sie gefragt wird, was sie braucht, sagt sie immer: Einen Ort, wo ich bleiben kann.
„Challo!“ sagt sie, auf mein „Hallo!“, als wir uns auf der Treppe begegnen. Ich habe es sehr schnell aufgegeben, auf Russisch oder Ukrainisch zu grüßen. Ein-, zweimal versuchte ich es. Und es kam, wie es kommen musste: Mein Gegenüber fing an, auf Russisch oder Ukrainisch zu erzählen. Ich verstand nichts. Mir war das peinlich. So grüße ich alle unsere Gäste freundlich – aber eben auf Deutsch. Damit ist es klarer. Für uns alle. Und jetzt zum ersten Mal antwortet jemand mit „Challo!“ Nach nur wenigen Tagen. Mir zuliebe vermute ich. Ich gehe weiter. Kurz nach mir trifft sie auf der Treppe ihre Schwester. Sie sagt „Challo!“, ihre Schwester antwortet auch „Challo!“ Beide lachen. Ich frage mich: Wer von den beiden hätte sich vorstellen können, dass sie einmal gemeinsam unter diesen Umständen sich auf einer fremden Sprache grüßen würden? Wie gut, dass sie einander haben.
Kurz nach mir trifft sie auf der Treppe ihre Schwester. Sie sagt „Challo!“, ihre Schwester antwortet auch „Challo!“ Beide lachen.
Sie lachen laut. Unverschämt laut für diese Uhrzeit: 23:10 Uhr werktags im Hinterhof unseres Gemeindehauses. Der Hof ist umgeben von ca. 20 Häusern. Und ich weiß: In jedem Haus, in jedem Schlafzimmer kann man jetzt dieses Lachen hören. Ich gucke aus dem Fenster. Sehe die Beiden: Zwei Jugendliche so um die 16 Jahre alt. Einige Tage sind sie schon bei uns. Der Eine kam aus Charkiw zu uns. Bei der anderen weiß ich es nicht. Jetzt fahren sie Fahrrad. Mal auf einem geschenkten Damenrad, dann wieder auf einem Kinderrad. Vielleicht probieren sie auch das Hello-Kitty-Dreirad, was im Hof zur freien Benutzung steht. Ich sehe es nicht. Aber ich höre sie umso lauter. Ich weiß, es nervt die Nachbarn. Einige werden sich ärgern. Ich denke: Ein Schild an den Ausgängen wäre gut – Nachtruhe ab 22 Uhr. Ich denke auch: Aber nicht mehr heute. Erst morgen. Und gehe ins Bett, lächle und denke: Eigentlich auch schön!
Ich denke: Ein Schild an den Ausgängen wäre gut – Nachtruhe ab 22 Uhr. Ich denke auch: Aber nicht mehr heute. Erst morgen.
Es regnet in Strömen. Heute reist er ab. Von Beginn an war er hier. Jetzt steht er neben einem alten Van im Innenhof. Umringt von Taschen. Mit ihm ein Keyboard. Vor wenigen Tagen haben wir für ihn noch Noten ausgedruckt. „Väterchen Frost“. Die sind irgendwo verstaut zwischen all dem anderen. Er legt seine kleinen Hände auf die vergilbte Packung. Schützt sein Keyboard vor dem Regen. Um sein Handgelenk das lila Bändchen. Auf dem steht: Ev. Markusgemeinde. Er braucht es jetzt nicht mehr. Er trägt es trotzdem noch. Das Zeichen, dass er einen Platz bei uns hat. Ich denke daran, wie wir ihn so oft zum Zahnarzt begleiten mussten. Wie ich ihn einmal auf dem Spielplatz gesehen habe – eine Stunde hat er an seinem Eis gegessen (3 Kugeln). Ich denke an sein kindliches Gesicht mit dem ernsten Blick. Und ich sehe ihn, wie geduldig er wartet. Da mitten im Regen. Bis das Auto fertiggepackt ist. Seine Mutter telefoniert. An ihrer Hand baumelt ein Schulranzen; er spricht (wie das Keyboard) von einem Neubeginn. Dahin reist der Kleine jetzt. Der Himmel weint. Und ich, weil ich ihn verabschiede, und weil ich hoffe, dass es ihm gut gehen möge, wohin er geht.
An ihrer Hand baumelt ein Schulranzen; er spricht (wie das Keyboard) von einem Neubeginn.
Die Tür des Großraumtaxis geht auf. Als Erste fällt uns die Kleine fast entgegen. So müde und geschafft ist sie. Nach und nach kommt ihre ganze Familie aus dem Taxi. Ihre drei Geschwister. Das Jüngste ein paar Wochen alt, an die Brust der Mutter gebunden. Der Vater schiebt einen Buggy mit einer Plastiktüte drin, ihr ganzes Gepäck. Mehr haben sie nicht. Wir bringen sie ins Haus und fragen, was sie brauchen. Schlafen, sagen sie, und trinken. Wir führen sie hoch, bringen Wasser herbei. Sie trinken, eine Flasche nach der nächsten. Ich habe noch nie gesehen, wie Menschen so viel trinken. Eine letzte Bitte: Ob wir Kinderschuhe hätten, die Schuhe des Sohnes seien zerschlissen. Haben wir. Dann legen sie sich hin, wie sie sind, und schlafen sofort ein. Wir verlassen das Haus. Im Stadtpark gegenüber singt die Nachtigall. Eine Freiwillige sagt: Gegen diese Menschen führt der im Kreml seinen Krieg. Am nächsten Morgen, ganz früh, brechen sie auf und reisen weiter. Sie wissen nicht wohin. Einige Zeit später sind sie wieder bei uns, eine Nacht nur, dann weiter. Wir hören, sie waren zwischenzeitlich in Frankreich. Immer unterwegs. Auch wenn es hier sicher ist, sie fliehen immer weiter.
Eine Freiwillige sagt: Gegen diese Menschen führt der im Kreml seinen Krieg.

Carolin Marie Goepfert ist Pfarrerin der Evangelischen Markuskirchengemeinde in Berlin-Steglitz.
Bilder: Klaus Böse, Bild C.M.Goepfert: Tine Fiedler