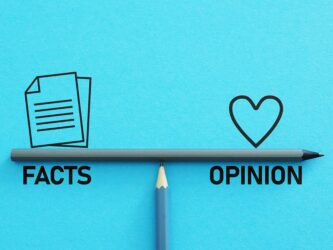Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler. Anlässlich dieses Gedenktages zeichnet Tom David Uhlig die erinnerungspolitischen Debatten um die ‚Wendezeit‘ nach und hinterfragt die Rollen, die Jüdinnen und Juden darin von nicht-jüdisch Deutschen zugewiesen werden.
Der missglückte Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944 ist Teil der staatstragenden „Erinnerungspolitik“ geworden: Jährlich finden an diesem Datum Feierlichkeiten der Bundesregierung und der Bundeswehr statt. Die Verschwörergruppe um Ludwig Beck, Henning von Tresckow, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und andere ist zu einem Symbol geworden, das offenkundig ins nationale Selbstbild integriert werden soll. Nicht selten wird dabei die Ambivalenz vernachlässigt, dass diese historischen Charaktere nicht nur unter Einsatz ihres Lebens die nationalsozialistische Führung ausschalten wollten, sondern auch Militaristen waren, von denen sich zwar einige zeitweise für eine „Humanisierung“ des Vernichtungskrieges einsetzten, gleichwohl sich an diesem aber federführend beteiligten. Die Idealisierung des militärischen Widerstands gegen Hitler nährt die Legende einer sauberen Wehrmacht, die letztendlich dann doch ihrem Gewissen gefolgt sei, und dient so der Legitimation ihrer Nachfolgeorganisation, der Bundeswehr.
harmlose Konfrontation
Insbesondere seit Mitte der 1980er bis Ende der 1990er Jahre hat ein Umdeutungsprozess stattgefunden, die Verbrechen Nazideutschlands wahlweise zu nivellieren oder aus ihnen eine „positive“ Identität abzuleiten. Diese Debatten rund um die sogenannte Wiedervereinigung prägten in ihrer Gesamtheit das, was heute unter Erinnerungskultur verstanden wird. Auch wenn eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Shoah und dem Vernichtungskrieg wünschenswert ist, liegt das Interesse dabei nicht immer in der „Aufarbeitung“, sondern vielmehr in der „Bewältigung“ der Vergangenheit. Die Verbrechen werden vielfach entkonkretisiert in Rituale des Gedenkens überführt – man will sich der Vergangenheit stellen, aber möglichst schmerzlos und mit dem dezidiert gewünschten „Nebeneffekt“, vor dem Ausland ein geläutertes Deutschland inszenieren zu können. Ein kursorischer Blick auf einige dieser Debatten, erhellt einerseits manche Grundlagen gegenwärtiger Erinnerungspolitik, und hinterfragt andererseits die Rollen, welche Jüdinnen und Juden von den nicht-jüdisch Deutschen dabei zugeteilt bekommen.
„Bewältigung“ statt „Aufarbeitung“ der Vergangenheit
„Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“, verkündet der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Rede zum Jahrestag der Befreiung 1985. Die Rede gilt als eine Art Startschuss der offiziösen Erinnerungspolitik. In pastoralem Tonfall sinniert Weizsäcker: „Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft“ und weiter dem „Leid um die Toten, […] Leid in Bombennächten, […] Leid durch Flucht und Vertreibung“ etc.[1] In der unterschiedslosen Aneinanderreihung wirft Weizsäcker die Täter- und Opfergruppen durcheinander, sodass am Ende der Eindruck entsteht, die Deutschen hätten wohl genauso gelitten wie ihre Opfer. Vielleicht sogar noch schlimmer, wird suggeriert, denn immerhin würden sie ja auch heute noch unter den Folgen des Krieges leiden: „Es lastet, es blutet, dass zwei deutsche Staaten entstanden sind mit ihrer schweren Grenze“, zitiert Weizsäcker.[2] Die unkonkrete Anerkennung deutscher Schuld mündet im Aufbau der Rede in Blut-und-Boden-Metaphern. Der instrumentelle Charakter der Rede, die „Wiedervereinigung“ herbeizusehnen, wird kaum verhohlen. Mit dem Geheimnis der Erlösung greift Weizsäcker ein jüdisches Sprichwort auf, verkürzt es um seine religiöse Bedeutung und übereignet es den Deutschen, die sich den Ausweg aus dem Schuldzusammenhang nun angeblich selbst weisen können.
die Normalisierung der Shoah
Wenige Zeit später, in den Jahren 1986/87, geisterte der „Historikerstreit“ durch das deutsche Feuilleton. Der konservative Historiker Ernst Nolte vertrat zum wiederholten Male in der Frankfurter Allgemeine Zeitung die geschichtsrevisionistische These, die Shoah sei in der Geschichte nicht singulär gewesen und überhaupt nur als „Reaktion“ auf das stalinistische Gulag-System zu erklären: „Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine ‚asiatische‘ Tat vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potentielle oder wirkliche Opfer einer ‚asiatischen‘ Tat betrachteten? […] War nicht der ‚Klassenmord‘ der Bolschewiki das logische und faktische Prius des ‚Rassenmords‘ der Nationalsozialisten?“[3] Dass Nolte diese Suggestivfragen umstandslos bejahte, zeigte er bereits in früheren Aufsätzen. Belege für diese haarsträubende These blieb er jedoch schuldig – keineswegs zufällig, denn es gibt keine, wie nachfolgend HistorikerInnen in der Debatte überzeugend darlegten. Es ist vor allem der Replik von Jürgen Habermas zu verdanken, dass Noltes Legendenbildung nicht unwidersprochen stehen blieb, sondern auf ihre Funktionen hin befragt wurde: Scharf kritisierte er den Versuch, über Umdeutungen der Geschichte deutschen Nationalismus zu rekonstruieren. Die Debatte war, wie Peter Borowsky feststellt, ohne jeden fachwissenschaftlichen Ertrag.[4] Allerdings zeigte der konservative Vorstoß in die Mitte des Bildungsbürgertums, wie fragil und angreifbar das deutsche Geschichtsbewusstsein zu sein scheint. Die Relativierung der Shoah ist auch heute (nicht nur) in rechten Kreisen ein beliebter Topos.
250.000 mordbereite Deutsche und ÖsterreicherInnen
In der „Nachwendezeit“ intensivierte sich die Diskussion um die schuldhafte Verstrickung der Deutschen. Jan Philipp Reemtsma und KollegInnen kuratierten 1995 die Wanderausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, genannt Wehrmachts-Ausstellung, auf die heftige Reaktionen sowohl seitens der bildungsbürgerlichen und konservativen Öffentlichkeit und Politik wie auch von militanten Neonazis folgten. Die triviale und genau dokumentierte Einsicht, dass die Wehrmacht keinen „normalen“, sondern einen Vernichtungskrieg im Osten Europas führte, der gesamte Militärapparat und keineswegs allein die SS den Massenmord betrieb, schien vielen Menschen so unaushaltbar, dass die Angriffe auf die AusstellungsmacherInnen immer bedrohlicher wurden. Beinahe zeitgleich, 1996, veröffentlichte Daniel Jonah Goldhagen seine Studie „Hitlers willige Vollstrecker“, in der er entlang der Untersuchung eines Polizeibataillons die These vertritt, die Mordkommandos haben ihre Verbrechen nicht gegen ihren Willen, sondern aus Überzeugung begangen. In Deutschland löste das Buch einen Skandal aus. Rudolf Augstein, Herausgeber des SPIEGELS, titelte „Der Soziologe als Scharfrichter“ (1996),[5] betonte immer wieder Goldhagens jüdische Identität und behauptete: „Daß die Deutschen ‚die Juden wirklich mit einer Leidenschaft gehaßt haben, die sich zu einer nationalen Psychose hochschaukelte‘; diese Behauptung Goldhagens ist natürlich purer Unsinn.“[6] Der Blick auf die massenhafte Involvierung der Deutschen in die Shoah zeigt, dass die These Goldhagens alles andere als Unsinn, sondern beinahe schon banal ist: 250.000 Deutsche und ÖsterreicherInnen waren direkt an der Ermordung beteiligt, nach Raul Hilberg war jede staatliche Institution – Bahn, Post, Schulen, Universitäten usw. – verstrickt, dazu noch etliche Industriezweige, mittelständische Unternehmen oder Privatpersonen. Ohne Berücksichtigung der antisemitischen Ideologie, die ein konstitutiver Bestandteil des Nationalsozialismus ist, lässt sich die in der Zustimmungsdiktatur entfesselte Mordbereitschaft nicht erklären.
Die erinnerungspolitischen Debatten der 1980er und 1990er Jahre zeigen immer wieder, wie ambivalent die Motive hinter der neu einsetzenden Konfrontation mit der deutschen Vergangenheit sind. Häufig geht es darum, über die Anerkennung zu einem international anerkannten nationalen Selbstbewusstsein zu finden. Dieser instrumentelle Charakter wird bisweilen kaum kaschiert und tritt dann besonders deutlich zum Vorschein, wenn es darum gehen soll, aus der Vergangenheit ernsthafte Konsequenzen zu ziehen: Es gibt immer noch zahlreiche Angehörige von Ermordeten oder Überlebenden, die nicht „entschädigt“ oder mit Lappalien abgespeist wurden. Jede als jüdisch erkennbare Einrichtung in Deutschland muss ständig unter Polizeischutz stehen und die Strafverfolgung von NS-TäterInnen kommt wenn dann nur schleppend voran. Wie auch die historiographische TäterInnenforschung in Deutschland erst in den 1990er Jahren in die Gänge kam, als die Täterinnen und Täter langsam aus Altersgründen ausstarben oder kaum noch befürchten mussten, zur Verantwortung gezogen zu werden, setzt die vorgebliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung zu einem Zeitpunkt ein, an dem die gesellschaftlichen Folgen absehbar minimal bleiben. Jüdinnen und Juden werden in dieser Erinnerungspolitik, die sich um das unsägliche Prädikat „Vergangenheitsbewältigung“ bemüht gemacht hat, wie StatistInnen behandelt, die den Deutschen ihre „Wiedergutwerdung“ bescheinigen sollen. Y. Michal Bodemann (1996) prägte hierfür den Begriff des Erinnerungstheaters, den Max Czollek (2018) kürzlich aktualisiert hat. Bodemann polemisiert gegen ein Gedenken, das im Zeichen des Vergessens steht. Die Rituale der Selbstläuterung schieben sich – um einen Freudschen Begriff zu benutzen – als „Deckerinnerung“ über das konkrete Geschehen und die eigene (familiäre) Involviertheit. Wenn Jüdinnen und Juden sich dem widersetzen, schlägt ihnen schnell sekundärer Antisemitismus entgegen, der Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, der im Zeichen der Schuldabwehr steht. Als 1998 Ignatz Bubis dem Schriftsteller Martin Walser nicht applaudieren wollte, als dieser öffentlich in der Frankfurter Paulskirche bekannt gab, er wolle von der „Auschwitz-Keule“ nichts mehr hören, galt Bubis vielen als starrköpfig und unnachgiebig. Dabei wäre doch auf eben solche jüdischen Stimmen zu hören, um nicht der Selbstgefälligkeit einer Erinnerungskultur zu verfallen, die glaubt, sich selbst den Weg zur Erlösung weisen zu können.
Autor: Tom David Uhlig ist Mitarbeiter der Bildungsstätte Anne Frank, wo er die Ausstellung „Das Gegenteil von gut. Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968“ kuratierte.
Beitragsbild: www.unsplash.com, Fredy Jacob
[1] Weizsäcker, R.v. (1990). Brücken zur Verständigung. Reden. Berlin: Verlag der Nation. S. 32f.
[2] Weizsäcker, R.v. (1990). Brücken zur Verständigung. Reden. Berlin: Verlag der Nation. S. 44.
[3] Nolte, E. (1986). Vergangenheit die nicht vergehen will. In: „Historiker-Streit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. S. 45.
[4] Borowsky, P. (2005). Wie geht die deutsche Geschichtswissenschaft mit der nationalsozialistischen Vergangenheit um? In: Ders., Schlaglichter historischer Forschung. Studien zur deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert (S. 63–87). Hamburg: Hamburg University Press. S. 75.
[5] Augstein, R. (15.4.1996). Der Soziologe als Scharfrichter. SPIEGEL. Online abrufbar unter: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8909530.html (11.07.2019).
[6] Nolte, E. (1986). Vergangenheit die nicht vergehen will. In: „Historiker-Streit“. Die Dokumnetation der Kontroverse um die Einzigartikeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung.