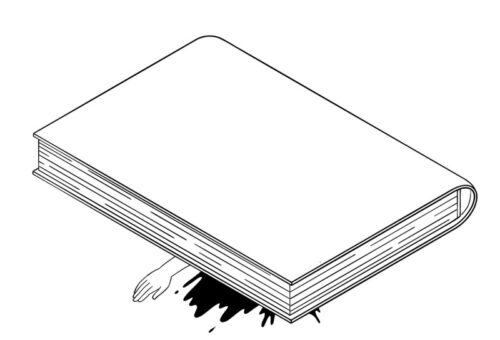Mit ihrer Arbeit „Tradition in Bewegung“ richtet Elisabeth Höftberger den Blick auf die fragilen Prozesse der Traditionsbildung im Christentum. Sie macht gerade im Bewusstsein für den Dialog und dessen Verletzlichkeit ein übersehenes Strukturelement dieser dynamischen Prozesse aus.
Tradition gibt Sicherheit! Das merken viele Menschen schon daran, dass die Tradition im innerkirchlichen Diskurs oder in der breiten Öffentlichkeit immer wieder auf unterschiedliche Weise als Argument in den Raum geführt wird. Was mit „Tradition“ jeweils genau gemeint ist, wird selten offengelegt, beeinflusst allerdings maßgeblich die Ergebnisse kirchenpolitischer Debatten oder theologischer Untersuchungen. Traditionshermeneutik, also die Lehre der Traditionsdeutung, die Kunst des Verstehens, mag auf den ersten Blick trocken, theoretisch und für das tägliche (kirchliche) Leben überholt erscheinen. Das ist sie aber ganz und gar nicht – im Gegenteil: Die Theologiegeschichte macht deutlich, dass Traditionskonzepte hochpolitisch sind. Die Absicherung von Tradition(en) baute immer wieder auf der Verletzung und Abwertung anderer auf, wie der Blick auf das Verhältnis von Christentum und Judentum im Laufe der Geschichte zeigt.
Die Deutung von Traditionen ist hochpolitisch.
Die theologische Abwertung des Judentums, die zunächst aus einer gegenseitigen Abgrenzungsbewegung der ersten Jahrhunderte resultierte, trug zu schrecklicher Verfolgung und Vernichtung bei. Teil dieser Abwertungsgeschichte ist auch eine hermeneutische Instrumentalisierung, in der nicht das Selbstverständnis von Jüdinnen und Juden zählte, sondern vorrangig deren Funktion für die eigene Sache. Im Rahmen der sogenannten Substitutionstheologie wurde das Volk Israel als verworfen dargestellt, der Alte sei durch den Neuen Bund abgelöst worden, die Kirche trete als „wahres Israel“ an die Stelle des Judentums. Der Gottesmordvorwurf an „die Juden“ wurde über Jahrhunderte hinweg tradiert. Der Historiker Jeremy Cohen beschreibt diese Funktionalisierung „der Juden“ im Mittelalter durch die christliche Theologie und Gesellschaft als „hermeneutical Jew“[1] – also das Bild „des Juden“, mit dem die eigene Tradition als überlegen dargestellt und in ihrer Autorität und Normativität bestätigt wurde.
Traditionsfixierung zeugt nicht von Stabilität, sondern von Verunsicherung.
Die Deutung von Traditionen war in der Geschichte der Kirche schon immer ein umkämpftes Feld. Traditionsfixierung zeugt nicht etwa von Stabilität und Einheit, sondern gerade von Unsicherheit und der Gefährdung von mündlichen, rituellen, liturgischen oder schriftlichen Überlieferungen. Weichenstellungen im Traditionsverständnis nahmen bereits die Verfasser:innen der biblischen Schriften vor. Auch die Zusammenstellung des katholischen Schriftkanons mit dem Konzil von Trient war bekanntermaßen eine sowohl theologische als auch politisch angestoßene Entscheidung in der Zeit der Reformation und Katholischen Reform. Der Kampf um die richtige Deutung von Tradition wurde erbittert geführt.
Besonders prägend für ein heute gesellschaftlich präsentes Bild kirchlicher Tradition, die Veränderungen abwehren möchte, war die sogenannte Neuscholastik ab dem 19. Jahrhundert. In einer Zeit weltpolitischen Machtverlustes und philosophischer Anfragen[2] an kirchliche Autorität wurde versucht, eine überzeitliche und überräumliche Geltung der kirchlichen Tradition zu implementieren, die sich so darstellen sollte, wie die damalige Theologie dies festlegte. Dem eigenen Machtverlust wurde eine universale Unverwundbarkeit entgegengesetzt, die mit einer Ablehnung etwa der Religionsfreiheit einherging.
Tradition entsteht in der Begegnung von Menschen und ist damit verletzlich.
Kirchliche Tradition besteht allerdings nicht unabhängig von Zeit und Raum. Sie wird von Menschen in individuellen Akten der Übergabe weitergegeben, die sich damit in eine lange Reihe, den Prozess der Überlieferung, einordnen wollen. Jeder dieser Akte ist eine Aktualisierung, denn Rezeption geht mit der Neuordnung von Traditionsbeständen wie Ritualen und Wissen einher. Zu dieser Organisation von kulturellem und religiösem Wissen gehört auch das Vergessen von solchen Beständen, das aus „Platzmangel“[3] im kollektiven Gedächtnis geschieht oder bewusst eingesetzt wird. Die Größen Zeit und Raum sind nicht so neutral, wie sie erscheinen mögen. Der Verweis auf die Neuscholastik hat gezeigt, dass ein bestimmtes Zeitkonzept einem politischen Ziel dienen kann. Tradition ist damit nicht linear und homogen, sondern zeigt sich als dynamischer Prozess.
Hier eröffnet sich ein Spannungsfeld von Einheit und Vielfalt: Tradition als Konzept wird oft mit dem Ziel der Identität und Einheit verbunden und dabei häufig strategisch instrumentalisiert. Schon durch die Art der Weitergabe entstehen aber zugleich unzählige Aneignungen und Adaptierungen, sodass Tradition immer aus Traditionen besteht. Tradition gibt es nur als Plural und in dynamischen Entwicklungen. Diese Vielfalt ergibt sich nicht zuletzt aus den Dimensionen von Tradition, die sich in heiligen Schriften, Gebeten und Riten der Liturgie, Entscheidungen der Konzilien und Päpste, theologischen Lehren, Bildern, Volkspraxis, mündlichen Erzählungen, alltäglichen Handlungen und Glaubenserfahrungen zeigt. Kann nach diesen Überlegungen überhaupt noch von Tradition im Singular gesprochen werden? Soll das Bild einer unveränderbaren, homogenen Tradition aufgebrochen werden, ist es sogar notwendig, den Begriff „Tradition“ in der wissenschaftlichen Reflexion nicht außen vor zu lassen. Gerade weil er häufig politisch instrumentalisiert wird, bedarf es einer Neucodierung, die die Pluralität „der Tradition“ mitdenkt. Tradition entsteht in der Begegnung von Menschen, die weitergeben, was ihnen aufgetragen wurde oder ihnen wichtig ist – ein an sich verletzliches und gefährdetes Geschehen. Dass gerade hier das Bedürfnis nach Absicherung besteht, verwundert nicht. Es stellt sich allerdings die Frage nach dem Wie.
Traditionsabsicherung ohne hermeneutische Gewalt?
Begriffe, theoretische Konzepte und Sprache haben reale Auswirkungen und können damit auch Gewalt ausüben. Ist Traditionsabsicherung ohne eine solche hermeneutische Gewalt, ohne Abwertung anderer Positionen möglich? Das ist sie, wenn sie sich der eigenen Unsicherheit stellt. Wiederum ist ein Blick auf das Verhältnis von jüdischen und christlichen Traditionen und die Entwicklung des interreligiösen Dialogs hilfreich. Das Zweite Vatikanische Konzil setzte 1965 mit der Erklärung Nostra aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen einen ersten, bereits lange notwendigen Schritt. Nach vielen Jahrzehnten kann mittlerweile eine Traditionsbildung dieses Dialoges beobachtet werden, die sich etwa in der Entstehung von Dialogdokumenten unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften zeigt. Die Dynamik kirchlicher Tradition ist hier unübersehbar. In einer Sensibilität für die nun über Jahrzehnte hinweg entstandenen Dialogpraxen kann eine dialogsensible Haltung in der Deutung von Tradition(en) entstehen. Ob auf Ebene der wissenschaftlichen Theologie oder des individuellen Austauschs: dialogsensibel zu sein bedeutet, das Risiko einzugehen, auch selbst angefragt und relativiert zu werden.
Dialog und die ihm eigene Fragilität werden Bestandteil der eigenen Tradition.
Dialogsensibilität macht verletzlich. Eine Position, die viele Verantwortliche in der Kirche, in religiösen oder politischen Institutionen abgewehrt haben, indem sie psychische, physische, sexuelle oder geistliche Gewalt auf andere ausgeübt haben – und das geschieht auch noch heute. Welche Rolle kann ein theoretisches Thema wie Traditionshermeneutik hier spielen? Menschen verletz(t)en Menschen im Dienst einer unverwundbaren, unantastbaren Tradition. Ein solches Konzept von Tradition ist politisch wirksam – aber nicht alternativlos. Als Wissenschaft, die von Gott, von Glaubenserfahrungen und deren Weitergabe spricht, hat auch Theologie eine Verantwortung dafür, verletzende Konzepte von Tradition offenzulegen. Hilfreich dabei kann eine dialogsensible Traditionshermeneutik sein, die sich der Gefahr von Instrumentalisierung und Marginalisierung anderer bewusst ist. Ein solcher Blick auf Tradition(en) ist geprägt von einer Skepsis gegenüber selbstverständlichen Deutungshoheiten und unhinterfragt etablierten Methoden und Quellen. Die Berücksichtigung vielfältiger Perspektiven und Quellen von Tradition(en) und ein intensiver Austausch mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen kann die Wahrnehmung für den Facettenreichtum scheinbar homogener Tradition schärfen. Dialogsensibilität impliziert das Bewusstsein für die Performativität des Dialogs, das heißt, Dialogprozessen wird zugetraut, dass sie Wirklichkeit beeinflussen. Dabei ist nicht ausschlaggebend, ob ein Konsens erreicht wird. Im kritischen Diskurs, in kontroversen Auseinandersetzungen oder im freundschaftlichen Gespräch verändern sich Perspektiven und es entstehen neue Sprachformen, die wiederum alternative Deutungen ermöglichen.
Dialog kann Deutungsmacht neu verteilen.
So kann Dialog in seinen unterschiedlichen Formen – ob interreligiös, mit gesellschaftlichen Gruppen oder den Einzelnen – tatsächlich etwas verändern. Deutungsmacht wird dann verteilt: Sie liegt nicht mehr bei der katholischen Kirche oder dem Lehramt allein. Ein solcher Blick auf das Konzept Tradition könnte stärker als bisher offenlegen, wo Theologie und Kirche Menschen verletzt haben, aber auch, wo es unerwartete Begegnung oder neutrales Neben- und Miteinander unterschiedlicher Religionen gab. Wo die Verletzlichkeit und Fragilität von Traditionsbildungen wahrgenommen und kommuniziert wird, kann Tradition Sicherheit geben, ohne andere zu verletzen.
___

Dr. Elisabeth Höftberger ist Postdoc im Forschungsprojekt “European Graduate School (Salzburg | Erfurt |Leuven): Theology in religious, cultural, and political Processes of Transformation” am Fachbereich Systematische Theologie der Universität Salzburg.
Aktuelle Veröffentlichung:
[1] Cohen, Jeremy: Living Letters of the Law. Ideas of the Jew in Medieval Christianity. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1999, 2.
[2] Vgl. Siebenrock, Roman A.: Zäsur: Neuscholastik, Antimodernismus. In: Hoff, Gregor Maria/Körtner, Ulrich H. J. (Hg.): Arbeitsbuch Theologiegeschichte. Diskurse. Akteure. Wissensformen. Band 2: 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart: Kohlhammer 2013, 185–197.
[3] Assmann, Aleida: Formen des Vergessens (Historische Geisteswissenschaften 9). Göttingen: Wallstein 2016, 14.
Foto: Pixabay.com
Porträtfoto: Martin Zierler