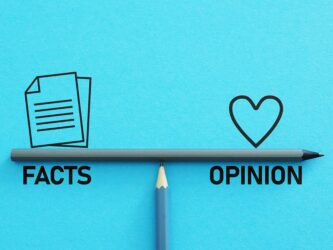Ob es für die Gesellschaft und Einzelne Vorbilder braucht, ist umstritten. Uwe Michler geht dieser zentralen Frage mithilfe des Romans „Das Vorbild“ von Siegfried Lenz nach.
Vor 50 Jahren – 1973 – erschien der Roman „Das Vorbild“ von Siegfried Lenz (1926-2014). Lenz beschreibt darin das Ringen und die Auseinandersetzung um geeignete Vorbilder für die Jugend 25 Jahre nach der Nazi-Herrschaft.
Fünf Jahre zuvor wurde sein Roman „Deutschstunde“, der die Schicksale verschiedener Menschen während der NS-Diktatur und die fatalen Folgen eines unhinterfragten Pflichtbewusstseins schildert, von der Kritik sehr positiv aufgenommen. Über 2 Millionen Mal verkaufte er sich und wurde in über 20 Sprachen übersetzt. Als Schullektüre in Deutschland haben ihn wohl auch einige hunderttausend Schüler*innen gelesen – und vielleicht auch durchlitten. Spätestens seit der „Deutschstunde“ galt Lenz neben seinen ein Jahr später geborenen Schriftstellerkollegen Martin Walser und Günter Grass als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Bundesrepublik.
Als nun fünf Jahre später der Roman „Das Vorbild“ erschien, war die Resonanz darauf deutlich negativer. Während Marcel Reich-Ranicki das „Vorbild“ fast 30 Jahre nach Erscheinen noch für ein wichtiges Buch hält (F.A.S., 05.02.2012), wurde es von vielen anderen Rezensent*innen damals eher kritisch bis ablehnend aufgenommen – nicht zuletzt auch, weil es manchen allzu konstruiert und pädagogisierend erschien.[1]
„Das Vorbild“
von Siegfried Lenz
Worum geht es? Drei von ihrer Herkunft wie auch ihrem Denken völlig unterschiedliche Pädagog*innen sollen im Auftrag eines Arbeitskreises der Kultusministerkonferenz ein Lesebuch erstellen. Da ist zum einen der konservative und pflichtbewusste Valentin Pundt, ein pensionierter Lehrer aus Lüneburg, dessen Sohn sich kurz nach bestandenem Staatsexamen das Leben genommen hat. Sodann der Lehrer Janpeter Heller, der für einen fortschrittlichen pädagogischen Ansatz steht und dessen Frau sich von ihm getrennt hat, weil er zu viel Zeit mit seinen Schüler*innen verbringt. Dritte im Bunde ist die kettenrauchende Dr. Rita Süßfeldt, die mit ihrer Schwester und ihrem Cousin zusammenwohnt, aber weitgehend konturlos bleibt.
Über das erste Kapitel des Schulbuches „Arbeit und Feste“ werden sie sich schnell einig, das zweite Kapitel „Heimat und Fremde“ gestaltet sich dagegen schon etwas schwieriger. Und nun treffen sie sich Ende der 1960er Jahre in einem Hamburger Hotel, um das dritte Kapitel „Lebensbilder – Vorbilder“ zu erarbeiten. Aufgenommen wird hier ein Motiv aus Lenz´ Deutschstunde, in der der 14jährige Gymnasiast und Roman-Erzähler Siggi einen Aufsatz mit dem Titel „Mein Vorbild“ schreiben muss – und er darin einen Mann schildert, der auf einer Zielinsel für britische Bomber die dort brütenden Vögel schützt.
Frage, ob es überhaupt
noch Vorbilder geben kann.
Die Frage ist natürlich auch, ob es in der Bundesrepublik 25 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs und dem moralischen Bankrotts der Nazi-Vergangenheit mit ihren unhinterfragten Idolen und vor dem Hintergrund der gerade damals anbrechenden Studenten*innen- und Jugendrevolte überhaupt noch Vorbilder geben kann.
Als einziger des Schulbuch-Trios sieht das auch der junge Pädagoge Janpeter Heller skeptisch, in dessen Ordner eine Notiz zu finden ist, auf der steht: „Fühle mit jedem, der Vorbilder nötig hat.“[2]
Die drei stellen sich nun gegenseitig Menschen vor, von denen sie glauben, dass sie heute Vorbilder sein könnten. Viele Vorschläge werden diskutiert und schließlich wieder verworfen, weil die Vorstellungen, welche Eigenschaften mit einem guten Vorbild verknüpft sind, weit auseinander gehen.
Verknüpfung von Vorbildern
mit dem eigenen Lebenswandel.
Gleichzeitig suchen alle drei Antworten auf persönliche Fragen in ihrem Leben. Und so wird die Suche nach einem zeitgemäßen, verbindlichen Vorbild für die Jugend Ende der sechziger Jahre mit dem gar nicht so vorbildlichen persönlichen Lebenswandel und Schicksal der drei Expert*innen verknüpft.
Klar scheint allenfalls zu sein, dass nicht mehr die großen Held*innen gesucht werden, sondern eher das stille Beispiel. Und nachdem Valentin Pundt aus dem Schulbuchtrio ausgestiegen ist, einigen sich die beiden verbliebenen schließlich auf ein Vorbild namens Lucy Beerbaum, eine Wissenschaftlerin, die zwei Jahre zuvor an Entkräftung starb, weil sie auf das Unrecht der griechischen Militärdiktatur hinwies.
Solidarität statt Held*innentum
Ihre Vorbildlichkeit besteht darin, dass sie während der Zeit der Diktatur aus Mitgefühl mit den Gefangenen freiwillig ganz unter deren Bedingungen lebt – mit den gleichen Einschränkungen, was Bewegungsspielraum, Besuchszeiten oder Nahrung angeht. Sie zeigt sich zwar auch sozialkritisch, wenn sie in einem Verhör sagt: „Ein Verbrechen am Schreibtisch oder im Konferenzsaal übergehen wir mit einem Achselzucken; für ein Verbrechen aus Armut aber oder aus Leidenschaft wollen wir kein Verständnis aufbringen.“ (255) Ihre Auflehnung versteht sie allerdings nicht in erster Linie als Protest, sondern als „demonstrative Anteilnahme“ (399) und Solidarität.
Zu wenig revolutionäres Potential.
Aber der Schulbuchverleger macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. Er ist nicht der Meinung, dass Lucy Beerbaum ein geeignetes Vorbild ist, weil sie zu wenig revolutionäres Potential habe und es Vorbilder brauche, die aktiv handeln und nicht vor allem mitleiden. Und so geht die Suche nach einem geeigneten Vorbild von vorne los…
Für den Schriftsteller Siegfried Lenz gehörten aktives Handeln und Empathie zusammen. Er war während seines langen Lebens politisch aktiv und hat sich für die SPD Willy Brandts und seines Helmut Schmidts engagiert – und sich auch immer wieder zu aktuellen Fragen mit Anteilnahme geäußert.
Lenz – einer mit weniger politischen Irrtümern.
So zitiert ihn der Feuilletonist Fritz J. Raddatz in einer Würdigung in DER ZEIT anlässlich der Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt mit den Worten: „Deshalb wäre eine Welt von Gleichgültigen eine Welt von tatenlosen Zuschauern, die aus grauen Felsengesichtern von ihren Logenplätzen herabblicken, ohne Erschütterung, ohne Mitleid, Wesen, in deren Adern Lack ist.“[3]
Siegfried Lenz ist – bescheiden und nie besserwisserisch auftretend – auch weniger politischen Irrtümern erlegen als seine Schriftstellerkollegen Grass und Walser: Grass manchmal überheblich und mit wenig Selbstkritik, was seine eigene Mitgliedschaft als Siebzehnjähriger in der Waffen-SS betraf, von der er erst spät Kenntnis gab. Und Walser, der von politisch weit links kam und 1998 einen Eklat auslöste, als er in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels von „Auschwitz“ und der Erinnerung daran als „Moralkeule“ und „Pflichterfüllung“ sprach.
Das tiefe Mitgefühl des Siegfried Lenz.
Lenz hingegen bleibt immer der bescheidene und große Geschichtenerzähler, der, wie er selbst schreibt, „mit den Mitteln der Sprache den Augenblicken unserer Verzweiflung und den Augenblicken eines schwierigen Glücks Widerhall verschafft.“ (zit. nach Raddatz ebd.) Er ist ein „Romancier von tiefer Menschlichkeit und Empathie“, wie ihn der israelische Schriftsteller Amoz Oz beschrieb.[4] Gerade seine späten und weniger umfangreichen Romane bzw. Novellen wie „Arnes Nachlass“ (1999), „Fundbüro“ (2003) oder „Schweigeminute“ (2008) zeugen von diesem tiefen Mitgefühl für seine Protagonisten in ihren schuld- und schicksalhaften Verstrickungen (und sind heute vielleicht lesenswerter als sein recht konstruierter Roman „Das Vorbild“).
Bleibt doch die Frage, ob es bei aller Vorsicht hilfreich sein kann, auf Vorbilder zurückzugreifen?
Margarete Mitscherlich, die 1978 ein Buch mit dem Titel „Ende der Vorbilder“ geschrieben hat, sagte auf die Frage, ob es heute genügend Vorbilder gebe, in einem Interview: „Da müssten Sie in den Familien nachsehen oder in den Schulen. Ich glaube, Vorbilder sind Menschen, die den Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass sie Interesse an ihnen haben, dass sie sie verstehen wollen.“ (DIE ZEIT, 22.02.2007).
In diesem Sinne sind es zumindest keine heroischen und besonders tugendhaften Vorbilder mehr, die wir heute brauchen, sondern Menschen, die durch ihre gute Tat Mut machen.
Die aktuelle Diskussion um Bismarck.
Ob dazu auch Reichskanzler Otto von Bismarck zählt, darf bezweifelt werden – nicht nur aufgrund seines Feldzugs gegen alle „Reichsfeinde“ – Liberale, Sozialist*innen, Katholik*innen und nationale Minderheiten. Ebenso ist es auch anachronistisch, einen Staatsmann als Vorbild zu propagieren, der „die Macht über das Recht, das Militärische über das Zivile und die staatliche Exekutive über die parlamentarisch-demokratische Willensbildung des Volkes“ (Andreas Wirsching) stellte. Eine andere Frage aber ist, ob er deshalb wirklich jakobinisch bilderstürzend „vom Sockel gestoßen“ werden muss, oder ob es nicht sinnvoller ist, sich in demokratischer Streitkultur mit seinem „Erbe“ kritisch auseinanderzusetzen.
Das Problem der falschen Heiligsprechungen.
Ähnliches gilt auch für den kirchlichen Bereich, in dem uns immer wieder Heilige/Selige als besondere Vorbilder vor Augen gestellt werden. In den letzten Jahrzehnten wurden geradezu inflationär Päpste selig- bzw. heiliggesprochen – darunter auch solche, die schon während ihres Pontifikates mit Recht kritisch betrachtet wurden aufgrund ihrer Machtausübung und Illiberalität. Doris Reisinger weist im „Christ in der Gegenwart“ zurecht darauf hin, dass in den vergangenen 122 Jahren weniger als drei Prozent der Heiliggesprochenen gläubige Laien waren, die weder ein Zölibatsversprechen abgelegt noch ein Martyrium erlitten haben. Und sie schlussfolgert: „Solange der ‚typische Heilige‘ ein weißer europäischer Priester ist, solange es keine afrikanische Mutter, keinen asiatischen Familienvater, keine lateinamerikanische Ärztin, keinen australischen Arbeiter gibt, die zur Ehre der Altäre erhoben worden sind, ganz ohne Martyrium und Keuschheitsgelübde, sondern einfach, weil sie in ihrem Beruf und ihrer Berufung ein heiliges Leben geführt haben, solange fehlt dieser Kirche etwas Wesentliches, das Vorbild und die Sichtbarkeit der Gemeinschaft der Heiligen, von denen nicht nur lumen gentium spricht.“ (CiG 44/2022)
Vorbild als Initiator
offener Suchprozesse.
Wieder zurück zu Lenz. Nach dem (vorläufigen) Scheitern des Schulbuchkapitels „Lebensbilder – Vorbilder“ lässt Lenz´ Roman es durchaus offen, ob es heute noch Vorbilder braucht. Aber er selbst würde das wohl bejahen – allerdings keine heroischen Vorbilder, sondern durchaus fehlbare und kritikfähige. Lenz selbst warnt ein Jahr vor der Wende in Rostock noch seine Zuhörer*innen: „Seht euch die genau an, die uns Vorbilder empfehlen, denen ihr nacheifert.“[5] Und er gibt 1992, knapp 20 Jahre nach Erscheinen seines Romans „Das Vorbild“, Schüler*innen die Erlaubnis, aus seinem Roman Passagen so umzuschreiben, dass sie aus Vorbildern auch Nichtvorbilder machen können und umgekehrt. In dieser kritischen und selbstreflexiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk kann er selbst Vorbild sein!
___

Uwe Michler ist katholischer Theologe und Priester. Er arbeitet als Seelsorger in Frankfurt am Main.
Titelbild: Vanessa Lai / unsplash.com
[1] So z.B. Hans Mayer, Nachsitzen in der Deutschstunde, Der Spiegel Nr. 34/1973, S. 92f.
[2] Siegfried Lenz, Das Vorbild, Hoffmann und Campe Hamburg 1973, S. 28.
[3] Zit. nach Fritz J. Raddatz, Meister der erzählten Moral, DIE ZEIT, 26.08.1999
[4] Amos Oz, Deutschlands Gewissen, F.A.Z., 20.03.2006
[5] zit. nach Kurt Reumann, F.A.Z., 03.08.1992