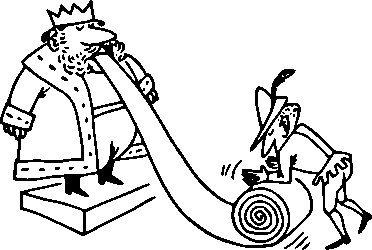Wie soll man noch von Gott und Glauben reden, wenn dabei viele Versuche in Peinlichkeiten und Banalitäten führen? In Auseinandersetzung mit einem Buch von Thomas Frings lotet Wolfgang Beck Abgründe und Potenziale gegenwärtiger Gottesrede aus.
Wie sollen Christ*innen, zumal auch Theolog*innen im 21. Jahrhundert noch von Gott und ihrem Glauben reden und schreiben? Durch Skandale um sexualisierte Gewalt, männerbündisch-klerikale Vertuschungen und lebensweltlichen Entfremdungen praktisch vollständig demontiert, scheint alles Reden vom Glauben bestenfalls verzichtbar. Nicht wenigen Menschen ist es längst ein Ärgernis. Das Reden von Gott hat sich, wenn es Formen naiver Einfalt zu meiden und die Anliegen der Negativen Theologie zu berücksichtigen versucht, wohl vor allem durch Zurückhaltung auszuzeichnen. Allerdings gehört das Reden vom Glauben zum christlichen Selbstverständnis, so sympathisch ein Predigt-Moratorium, ein selbstverordnetes Schweigen, auch erscheinen mag. Einfach den Mund zu halten, ist in der Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben keine Option.
Fluchtstrategien derer, die nichts mehr zu sagen haben.
Wo das Reden über den Glauben also dennoch versucht wird, entstehen schnell Peinlichkeiten. „Fremdschämen“ gehört zum kirchlichen Tagesgeschäft. Die einen versuchen es mit dem Einstieg ins Seichte und Gefühlige. Engel und Kerzen, Pilgern und Sinnsprüche – in diesen Themen kann man nicht viel falsch machen und Auflagen erzielen. Warum lange mit dem vernunftorientierten Diskurs aufhalten, der ohnehin kaum Glücksgefühle erzeugt? Auch die Flucht in hohl gewordene kirchliche Floskeln ist als Ausdruck von Sicherheitsbedürfnissen verständlich, wenngleich nicht hilfreich. Darin liegt eine zweite Option. Sie wirkt zwar meist grotesk, eröffnet aber ein binnengemeindliches und binnenklerikales Exil, das noch für die Dauer der eigenen Lebensspanne halten mag. Die „Plausibilitätsinseln“, die für diese Selbstexilierung nötig sind, werden allerdings zunehmend kleiner und müssen mit zunehmendem Kraftaufwand abgeschirmt werden.
Immunisierung gegenüber Verunsicherung
Andere flüchten sich in eine „Jetzt-erst-recht“-Logik, bedienen sich einer Missionsterminologie, die sich bei näherer Betrachtung als populistisch und häufig auch manipulativ entpuppt. Unter Verzicht auf historisches Bewusstsein und theologische Differenzierung wird in diesem Feld in einer Leichtigkeit vom erfüllenden und beglückenden Glauben gesprochen – ohne Stocken, ohne Atempause, ohne eigene Irritation. Wer in solche, sich selbst euphorisierenden Kreise mit ihren selektiven Bibelbearbeitungen gerät, kann über die Energie dieser Binnenplausibilitäten staunen. Ihre Strategie der Immunisierung gegenüber Unsicherheiten, Kompromissen und kritischen Anfragen erfordert den hohen Preis gesellschaftlichen Rückzugs und verrät wichtige theologische Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Immunisierung gegenüber Verunsicherung, so lautet hier das unausgesprochene Programm.
Gibt es weitere Alternativen zu den Gefühligen, zu den Unsicherheits-Immunen und den Entschiedenheits-Euphoriker*innen? Wie könnte ein Reden vom Glauben gelingen, das sich auch an verhaltenen Reaktionen ehrlich erfreuen kann, etwa einem „Aha, alle Achtung!“ oder einem „Immerhin nicht so schlimm wie sonst!“
Wenn ein Theologe sagt, er kann nicht beten.
Der katholische Theologe und Pfarrer Thomas Frings, der noch 2017 begleitet von großer medialer Aufmerksamkeit seinen Abschied vom Gemeindedienst als Pfarrer in Münster mit der Frustrationsschrift „Aus. Amen. Ende?“ über die Mittelmäßigkeit seiner Mitchrist*innen nahm, legt nun einen Versuch der Rede über den Glauben vor. Nach Klosteraufenthalt, reisender Referententätigkeit und neuem Dienstbeginn in Köln liegt nun sein zweites Buch auf dem Tisch: „Gott funktioniert nicht“. Darin beschreibt er in sehr persönlicher Form sein eigenes Glaubensringen, seine Unfähigkeit zu allzu leichtgängigen Gebeten.
Das Risiko der religiösen Rede
Das ist sehr nüchtern, erfreulich nüchtern. Denn es ist nicht nur offen, sondern auch ehrlich. Es passt für Frings nicht, in naiven Formen des Redens Gott zu instrumentalisieren. All das ist theologisch nicht neu, in der Spiritualität der Nacht erlitten, in der Negativen Theologie reflektiert. Aber angesichts der beschriebenen Alternativen und ihrer Vehemenz ist es doch auch wohltuend. Gut vorstellbar, dass manche Leser*innen auch genervt darauf reagieren, dass hier ein Christ von sich und den eigenen Erfahrungen erzählt. Der Vorwurf wäre leicht zu machen, dass sich hier einer zu wichtig nimmt. Das gehört zum Risiko derjenigen, die es überhaupt noch wagen vom christlichen Glauben zu sprechen und dessen Relevanz für das eigene Leben zu suchen. Ich nehme ihm ab, was er schreibt – das ist viel im Jahr 2019.
Eine redliches Sprechen
Es ist ein über weite Strecken beeindruckend unprätentiöses Sprechen über den eigenen Glauben, das es sich nicht leichtmacht und gerade deshalb zeitgemäß ist. Frings schreibt redlich und aufrichtig über den eigenen Glauben und bildet damit eine Basis, von der aus Zweifel und Atheismus als Vertraute gewürdigt werden können.
Warum ist nur Gott zerknittert, nicht aber die Menschen?
Wie wenig selbstverständlich diese Art des Redens über den Glauben ist, kann erschrecken. Gott funktioniert nicht, das Schreiben von ihm und das Reden mit ihm ist zerknittert, nicht elegant, nicht widerspruchsfrei, auch nicht unbedingt hilfreich. Das Reden von Gott muss keine Funktion erfüllen. Gerade darin ist diese Form, vom Glauben zu sprechen, vielen Menschen ziemlich nah.
Befremdliche Idealvorstellungen halten sich.
Das gilt weniger für die lückenlose kirchliche Prägung, die Frings noch erlebt hat. Es gilt auch nicht für seine kirchlichen Idealbilder, in denen es eine Neigung zu Pädagogisierungen gibt (39). Wenn er das Ringen um den Glauben offenhält für Ungereimtheiten und Uneindeutigkeiten, dann stellt sich die Frage, warum sich diese liebevolle Gelassenheit nicht weit mehr auch auf seine Wahrnehmung von Mitmenschen überträgt. Warum ist bei ihm Gott zerknittert, nicht aber die Menschen und sein Blick auf sie? Hier halten sich die befremdlichen Idealvorstellungen und kirchlichen Normierungen, hier wird von der Theologie eine künstliche Eindeutigkeit erhofft: „Theologie ist als Wissenschaft einer Eindeutigkeit verpflichtet, die Religion so kaum für sich in Anspruch nehmen kann.“ (127). Man kann sich als Leser*in fragen, warum Frings dieses Bedürfnis nach Eindeutigkeit pflegt, wo er sie selbst doch nicht aufzubringen vermag.
Rückfall in alte Muster und kirchliche Normative
Die Redlichkeit seines Ringens im persönlichen Glauben trifft auf das stabile kirchliche Gefüge, in dem er klar weiß, wo die Prioritäten liegen. Da wird mit fragwürdigen Bildern drauf los katechetisiert, dass es mit der Eucharistie, wie mit dem Brief seiner Mutter ist (131). Beides sei ähnlich mit der Präsenz der Nicht-Sichtbaren aufgeladen – auf dass die Kinder doch endlich kapieren, was ihm heilig ist und was die Sakramente bedeuten. Hier eine Klärung zur Bedeutung der Eucharistie, dort eine allzu leichte Werbung für die Beichte: „In der Beichte will Gott den Menschen verwandeln durch seine Barmherzigkeit.“ (137) Richtig, sicherlich. Aber doch nur ein Rückgriff in abgenutzte, wirkungslos-binnenkirchliche Sprache. Das hilft zwar niemandem, aber es fungiert eben als binnenklerikale Währung. Da bleibt wenig übrig von dem anfangs spürbaren redlichen Ringen. Warum braucht es diese Rückgriffe? Als Absicherung?
In kirchlicher Prägung deformiert?
Genau hier wird das Risiko der ehrlich verunsicherten Gottesrede sichtbar: sie erlaubt keine Rückfälle in vorgegebene kirchliche Worthülsen. Entweder hat hier ein Theologe seinem eigenen Glaubensringen nur bis zur halben Strecke getraut und ist aus Angst, wohin ihn dieser Weg führen könnte, doch in die nicht mehr tragfähigen aber innerkirchlich etablierten Sprachspiele geflüchtet. Man ahnt hier, welche Verunsicherungen im Blick auf Mitmenschen, kirchliche Vorgaben und die eigene Existenz der weitere Weg dem Autor eingebracht hätten. Oder aber die Darstellung des persönlichen Suchprozesses ist nur ein Stilelement, um den Leser*innen doch die klassischen Vorgaben von Sakramenten, traditionellen Glaubensformeln und hohl gewordenen kirchlichen Muster nahe zu bringen.
Ein halbes Ringen schmeckt schal.
Was bleibt, ist der Eindruck, dass ein halbes Buch, ein stockendes Reden manchmal besser wäre. Dass große Theolog*innen ihre Werke immer wieder auch unvollendet ließen, kann von einem Zurückschrecken im Sprechen über Gott und Glaube zeugen. Solch ein Zurückschrecken drückt dann die größte Leistung aus und ermutigt zum eigenen Denken und Suchen. Die Redlichkeit in der Darstellung des eigenen Weges stellt sich als vertretbarer, überzeugender Weg der religiösen Kommunikation dar, doch dürfte er gerade nicht in Eindeutigkeiten aufgelöst werden. Doch die Frage bleibt: Wenn Gott nicht funktioniert, warum wird es dann von den Menschen gefordert?
___
Autor: Wolfgang Beck, Mitglied der feinschwarz-Redaktion, Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik an der PTH Sankt Georgen, Frankfurt/M.
Foto: Samuel Zeller, unsplash.com
Literaturhinweis: Frings, Thomas: Gott funktioniert nicht. Deswegen glaube ich an ihn, Freiburg/B. 2019, Herder-Verlag, ISBN 978-3-451-38026-6.