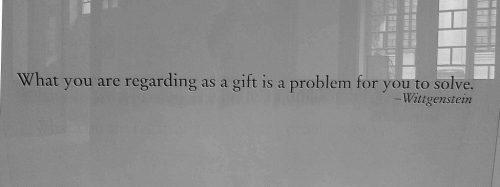Der emeritierte Philosophieprofessor und katholische Priester Alexius Jakobus Bucher blickt zurück und identifiziert spezifische Defiziterfahrungen als produktive Markierungen seines Lebenswegs.
Wann hab ich mich zum ersten Mal gefragt: „Was fehlt da eigentlich?“ Als Kriegskind der Jahre 1942 bis 1945: Haben mir da Friede und Geborgenheit gefehlt? Als Junge der Jahre des Wirtschaftswunders: Haben mir da Freunde gefehlt? Wie lange hat mir kindliche Unschuld vorgesungen: „…ist alles wohl bestellt, der Acker und das Feld?“ – die Familie, die Erziehung, die Schule. Es war tatsächlich die Kirche, die mich aus meinem naiven Schlummer weckte.
Es war die Kirche, die mich aus meinem naiven Schlummer weckte.
Seit Kindes Beinen hat mein Vater die Sonntagspredigt kritisiert, zum Ärger meiner frommen Tanten. Leider fehlten mir als Ministrant die richtigen Argumente, meinen Kaplan gegen väterliche Kritik zu verteidigen! Der Ex-Kriegspilot stach den priesterlichen Russlandheimkehrer argumentativ aus.
Später, als Oberschüler, fehlten mir die stichhaltigen Argumente, um die neu-scholastischen Quisquilien meines studienrätlichen Religionslehrers zu konterkarieren. Ich ahnte, dass der ‚graue, dann grüne‘ Katechismus falsche Fragen stellte, weil Erfahrung ausgeklammert blieb.
Ich ahnte, dass der grüne Katechismus falsche Fragen stellte, weil Erfahrung ausgeklammert blieb.
Diese Ahnung lenkte mich über die Pfarrbücherei hinaus zu Autoren, die dort fehlten: Graham Greene, Bernanos, ja auch Thomas von Aquin, Romano Guardini.
Mein Philosophiestudium begann ich mit großen Hoffnungen, meinen Dilettantismus im Bewältigen entdeckter Defizite zu korrigieren. Die Theologische Fakultät in Bamberg erwies sich bald als Hoffnungstilger. Forschung und Lehre waren ängstlich darauf bedacht, wacklige theologische Positionen wieder zu zementieren. Neuscholastik en gros und en detail verstopfte den Zugang zu kritischer Reflexion.
Dann forderte ich, was bislang nur dank bischöflich angefordertem Gnadenerlass möglich war: Studium in Frankfurt/St. Georgen bei den Konzilstheologen Semmelroth, Rahner, Grillmeier, etc. Meine Defizitanalysen an Kirche und Theologie wurden in St. Georgen ernst genommen. Mir fehlte in Frankfurt außer der gelegentlich vermissten Harmonie zwischen Konzilstheologie und einer adäquaten Liturgie kaum etwas.
Was sollte ich nach meinem Studienabschluss anfangen? Es ist die Zeit, in der Martin Luther King seine Träume veröffentlichte! War das mein Traum: jenen helfen, die ähnliche Defizite beklagten? Defizite der Menschen bezüglich Lebensqualität beheben? Defizite der Kirche bezüglich ihrer Optionen für Lebensqualität erkennen und korrigieren? Fehlte mir dazu noch die Priesterweihe? Jedenfalls damals glaubte ich: ja, das wäre notwendig.
Die Gründe, die mich Priester werden ließen, sind nicht die gleichen, die mich Priester bleiben ließen.
Bis heute habe ich diesen Irrtum nicht bereut. Etwas harmloser formuliert: Die Gründe, die mich Priester werden ließen, sind nicht die gleichen, die mich Priester bleiben ließen.
Den character indelebilis habe ich seit 1965, gefehlt hat mir eine Einführung in die Pfarrpraxis. Schlimmer: Ich hab dieses Defizit erst sehr spät entdeckt, weil ich meinte, meine Pfarrjugendvergangenheit wäre schon damals entschieden zeitnäher gewesen als die Pfarrpraxis des Klerus meiner Vergangenheit und Gegenwart. Die Reue über erst nachträglich entdeckte Defizite konnte nur sein: sensibel zu werden für präsente Defizite. Ich forderte praxisbegleitende kompetente Reflexion bei meinen vorgesetzten Behörden, leider vergeblich.
Die Unterscheidung zwischen individuellen und strukturell vorgegeben Defiziten erwies sich als so hilfreich wie bedrückend. Meine Kirche als Pfarrei – zunächst an der Zonengrenze Nordbayerns – erlebte ich als um den Tisch versammelte Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Sehnsucht und Enttäuschung, Glück und Überforderung. Meine Kirche als Arbeitgeber erlebte ich organisiert in Institutionen: Bischöfliche Ordinariate und Theologische Fakultät – zwei Funktionsträger mit gravierenden Handlungsdefiziten.
Ordinariate verstand ich als freigestellte personale und finanzielle Kapazitäten im Dienste kirchlicher Selbstverwirklichung. Sie sollten Hilfen für Priester vor Ort erarbeiten, damit im Erlebnisraum heutiger Menschen die Sache Jesu erkennbar wird. Das hätte bedeutet: Systematische Zuarbeit im Dienste der Verkündigung mitten in der Welt und für die Welt, primär für die Notleidenden, Kranken, Gefangenen, die Trauernden, Hungernden, Dürstenden nach Gerechtigkeit, nach einem Leben in Fülle! Was läuft fehl, wenn sich sowohl auf der Seite der gutwilligen Akteure dieser Kirche wie auf der Seite der „Kinder dieser Welt“ der Eindruck verfestigt: Die Wirklichkeitserfahrungen unseres hierarchischen und unseres wissenschaftlichen Organisationsstabes trennen Welten, untereinander und erst recht in Bezug auf die Erfahrungen jener, in deren Heilsdienst sie stehen?
Was läuft fehl, wenn die Wirklichkeitserfahrungen von Theologie und Hierarchie Welten trennen von den Erfahrungen jener, in deren Heilsdienst sie stehen?
Kein Wunder, wenn die Fragen, Nöte, Ängste, Hoffnungen und Sorgen der Menschen von heute in ihrer Pluralität nur höchst partiell gekannt oder gar anerkannt werden, und kaum eine Chance besteht, sie kompetent im Licht des Evangeliums auszuleuchten, geschweige denn Antworten, Hilfen im Geist des Evangeliums zu realisieren.
Nach Kaplans- und Pfarrdienstjahren stand mein Entschluss fest: zurück an die Universität, meine Diensterfahrungen aufarbeiten und Perspektiven entwickeln, die mir die Texte des II. Vatikanischen Konzils vorgaben. Die vergangenen letzten Jahre hatten in Kirche und Staat Umwälzungen provoziert. Richard Nixon wird Präsident, M. L. King wird ermordet, die Beatles veröffentlichen „Yellow Submarine“.
… die Zeichen meiner Erfahrungswelt auf den Begriff bringen.
Mein eigener Neustart konzentrierte sich um die Erkenntnis: Wenn ich effizient meinen Verkündigungsauftrag ausführen will, muss ich die Zeichen meiner Erfahrungswelt auf den Begriff bringen. Die Wissenschaft, die das leisten müsste, sah ich in der Philosophie der Gegenwart. Klar, dass meine Perspektive auf die Universität nicht mehr identisch war mit jener nach dem Abitur. Wie viel war dieser andere Blickwechsel auch meiner neuen Perspektive auf Kirche geschuldet? Jetzt erlebte ich Kirche im Modus einer Fakultät.
Einzelkämpfer wie Karl Lehmann, damals junger Professor an der Universität in Mainz, verstärkten den Eindruck fehlender innerfakultärer Diskurse. Wenn Erfahrungen des modernen Menschen innerhalb des theologischen Forschungsobjektes ausgeklammert bleiben, wie können da die Zeichen der Zeit zum Material theologischer Reflexion werden?
… begriffsvernebelte Pseudoinkarnation anstelle erfahrungsermutigender Optionen.
Ist es dann verwunderlich, wenn zeitgeprägte Subjektivität des Forschers unreflektiert in die Forschungsergebnisse einfließt? Dieses Faktum ist für mich wesentlich Ursache, warum das, was oft als christliche Botschaft verlautet wird, den Hörer nicht betrifft. Nicht, weil der „Hörer des Wortes“ nicht hören könnte oder wollte, sondern weil unter diesen Voraussetzungen christliche Botschaft sich nicht in nachvollziehbare Erfahrungen konkretisiert: begriffsvernebelte Pseudoinkarnation anstelle erfahrungsermutigender Optionen.
Von der Zonengrenze aus unterbreitete ich damals dem Bischof den Vorschlag, in jedem Dekanat sollte ein Pfarrer in einer der theologischen Disziplinen Spezialkenntnisse besitzen. Das erschien mir als Chance, pastorale Praxis vor Ort und wissenschaftliche Kompetenz in einer Person zu realisieren, und so Praxis auf ihre Inkarnationsleistungen und Theorie auf ihre Botschaftsrelevanz hin zu optimieren und zu evaluieren. Der Kommentar des damaligen Bamberger Bischofs: „Warum wollen Sie wieder studieren, Sie kommen doch in der Praxis gut zurecht!“
Frankfurt 1968 und Mainz 1968
Frankfurt 1968 und Mainz 1968: Meine neuen Studienorte waren sehr auffällig nicht mehr vergleichbar mit der Jesuitenfakultät 1964. Doch mir ging es nicht um den Muff unter den Talaren. Zu viele Löcher waren bereits in die Tradition und Traditionen gerissen. Was müsste ich der Theologischen Fakultät abfordern, um die in der pastoralen Praxis entdeckten Defizite zu beheben?
Mein Glück war, dass mir die drei Jahre Praxis das Auge schärften für die Defizite des Universitätsbetriebes von Theologie und Philosophie selber. Nicht von Zion her, auch nicht von Hellas her, sondern von jener Philosophie her erwartete ich Hilfe, die ihrerseits heftige Selbstzweifel diskutierte, wessen Geisteskind sie eigentlich sei. Sind ihre Eltern Wissenschaft und Lebenskunst, oder ist sie Abkömmling einer Dirne, genannt Metaphysik?
Die „Frankfurter Schule“ half mir, meine gesellschaftskritischen Defizite zu bearbeiten. Heidegger grüßte überraschend zur Promotion und half, meine ontisch-ontologischen Differenzen auf den Umweg über Bultmann und Rahner zu entmythologisieren. Und mit Kant und den husserlschen Lebenswelten entdeckte ich Philosophie als und über die Methode.
Der theologie-philosophische Rundumschlag zeitigte riskante Nebenwirkung. Ich formulierte ein neues Dogma (oder nur eine neue Methode): „Mit kritischem Bewusstsein kannst Du nicht in der römisch-katholischen Kirche bleiben!“ Beziehungsweise: „Nur mit kritischem Bewusstsein kannst Du in der römisch-katholischen Kirche bleiben.“
„Mit kritischem Bewusstsein kannst Du nicht in der römisch-katholischen Kirche bleiben!“
Beziehungsweise: „Nur mit kritischem Bewusstsein kannst Du in der römisch-katholischen Kirche bleiben.“
Das Ende des Mittelalters war entschieden, als Gott nicht mehr für den universal plausiblen Grund sowohl allen Seins aber auch allen sittlichen Handelns zitiert werden konnte. Das Ende der Moderne war entschieden, als die Vernunft nicht mehr als universal plausibler Grund allen Erkennens und Wollens gelten konnte. Weder zur Begründung einer Moral noch zum Finden eines tragfähigen Lebenssinnes braucht es einen Transzendenzbezug, geschweige denn theologische Vorarbeiten.
Weder zur Begründung einer Moral noch zum Finden eines Lebenssinnes braucht es einen Transzendenzbezug, geschweige denn theologische Vorarbeiten.
Christentum ist zu einem gediegenen Lebensglück nicht notwendig. Sinn-, Wert- und Moralfragen werden säkular gestellt und zumindest vergleichbar plausibel beantwortet und begründet. Ist dann aber, außer als historisches Epiphänomen, Theologie an einer Universität notwendig? Fehlt der Welt etwas, wenn das Christentum fehlt? Stellt sich die Theologie diese Frage und dieser Frage?
Wie in jeder Frage bereits der Ansatz ihrer Antwort grundgelegt ist, steckt in jeder Defiziterkennung bereits mehr als die Hoffnung, auf eine ergebnisoffene Behebung. Meine Hoffnung wäre: Lebt der Mensch nur vom Notwendigen? Kann eine Universität nur leben vom unbedingt Notwendigen? Sind wir nicht existentiell auf Transzendieren des Notwendigsten angelegt, prinzipiell unzufrieden, prinzipiell unruhig, prinzipiell auf Horizonterweiterung, auf „super plus“ angelegt?
Wir, die prinzipiell unzufriedenen Wesen. Woher sonst kommen unsere Defiziterfahrungen und Enttäuschungen? Die Erfahrung, dass etwas fehlt und der Wunsch das Fehlende überhaupt erst noch jenseits unseres bekannten Horizontes zu suchen, der Übergang von der Agnostik in die Gnosis, dieser Charakter wird uns zeitlebens definieren, begrenzen und bestimmen.
Die Erfahrung, dass etwas fehlt und der Wunsch, das Fehlende erst noch zu suchen, das wird uns zeitlebens definieren.
Das verkennt unser Leben nicht als ein Glasperlenspiel oder als Lotterie, sondern fordert gewissenhaftes und riskantes Entscheiden. Ich habe mir den Luxus erlaubt und bin damit gut gefahren, mein Leben im Lichte eines Jesus von Nazareth entschieden zu begreifen und zu gestalten. Das bleibt der Grund meiner Hoffnung.
(Alexius J. Bucher; Bild: Rainer Bucher)
Ausführlicher: Alexius J. Bucher, Defiziterfahrungen in biographischer Hinsicht. Ein theologiekritischer Rückblick, in: R. Bucher/R. Oxenknecht-Witzsch (Hrsg.) Was fehlt? Leerstellen der katholischen Theologie in spätmodernen Zeiten. Ein Experiment, Würzburg 2015, 255-261.