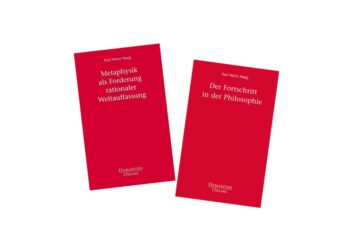Claudia Janssen über die Schließung der KiHo Wuppertal.
Am 6. Februar 2025 fasste die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland den Beschluss, den Betrieb der von ihr maßgeblich finanzierten Kirchlichen Hochschule „in ihrer bisherigen Form spätestens bis zum 31.03.2027 zu beenden.“ Aus Finanzgründen – im selben Jahr, in dem die KiHo das 90. Jubiläum ihrer Gründung feiert. Damit endet auch die über 50jährige Geschichte der Feministischen Theologie an der Hochschule.
aus Finanzgründen
Die Bekennende Kirche verfasste 1934 im Widerstand gegen die nationalsozialistische Gleichschaltung die „Barmer Theologische Erklärung“ und beschloss, eine eigene theologische Ausbildungsstätte in Wuppertal einzurichten. Diese wurde am 1. November 1935 eröffnet und kurz darauf von der Gestapo geschlossen. In den folgenden Jahren fanden alle Aktivitäten und Prüfungen im Untergrund statt. 1945 wurde der offizielle Lehrbetrieb erneut aufgenommen. 2007 fusionierte die KiHo mit der kirchlichen Hochschule Bethel und steht seit 2022 am Standort Wuppertal eigenständig für die gemeinsame Tradition.
widerständige Theologie
Widerständige Theologie – kirchennah und zugleich kirchenkritisch – gehört seit der Gründung zum Profil der KiHo. Von staatlicher Finanzierung unabhängig, mit einem engagierten theologisch profilierten Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen, kontextuell, biblisch verankert und wissenschaftlich zukunftsweisend, so versteht sich die Hochschule. Jürgen Moltmann verfasste hier in den 1960er Jahren sein wegweisendes Werk einer Theologie der Hoffnung. Bereits im Sommersemester 1974 gründeten Studentinnen in Bethel eine Frauengruppe und arbeiteten autonom zum Thema „Frau in Theologie und Kirche“, eng verbunden mit den Zielen der politischen Frauenbewegung. Sie stellten sich damit in die Tradition des Kampfes evangelischer Theologinnen für Gleichberechtigung in der Kirche, die es in Deutschland organisiert seit den 1920er Jahren gibt. Mit ihrer Initiative begann der lange, mühsame Weg der Institutionalisierung wissenschaftlicher Feministischer Theologie und Theologischer Geschlechterforschung an der Hochschule, der 2027 enden wird.
es bleiben Wut, Trauer, Ohnmacht und Unverständnis
Für alle, die sich mit der KiHo verbunden fühlen und sich über lange Zeit auf verschiedenen Ebenen für den Erhalt eingesetzt haben, ist das schmerzhaft. Es bleiben Wut, Trauer, ein Gefühl von Ohnmacht und vor allem Unverständnis über die Entscheidung, sich von der für die evangelischen Landeskirchen von Rheinland und Westfalen identitätsbildenden Einrichtung zu verabschieden. Es passt in den Geist der Zeit, eine „Akademisierung“ kirchlicher Praxis abzulehnen und angesichts finanzieller Engpässe wissenschaftliche Theologie für einen Luxus zu halten, auf den Kirche gut verzichten und die Verantwortung dafür allein an staatliche Fakultäten delegieren könne.
2025 ist nicht 1935 und doch …
2025 ist nicht 1935 und doch lassen Genderverbote aufhorchen, die verschiedene deutsche Landesregierungen für ihre Einrichtungen ausgesprochen haben. Universitäre Institute für Geschlechterforschung stehen seit Jahren unter Dauerkritik rechtspopulistischer Parteien, denen es offensichtlich gelungen ist, den öffentlichen Diskurs zu verschieben. In dieser Zeit gesellschaftlicher Transformationen, des globalen Erstarkens rechtsextremer Parteien und rechtpopulistischer Regierungen ist die Entscheidung eine Hochschule zu schließen, die einen herausragenden Ruf im Bereich Feministischer Theologie und theologischer Geschlechterforschung genießt, fahrlässig, theologisch und (kirchen-)politisch fatal – ein Signal in die falsche Richtung.
50 Jahre Feministische Theologie an der Kirchlichen Hochschule sind ein Grund zum Feiern.
Ein Blick zurück: 50 Jahre Feministische Theologie an der Kirchlichen Hochschule sind ein Grund zu feiern, denn sie schreiben eine Erfolgsgeschichte, die grundlegende Veränderungen in Theologie und Kirche bewirkt hat. Als erste Professorin in Wuppertal lehrte Susanne Hausammann seit den 1970er Jahren im Fach Kirchengeschichte. Ihre Sozietät zu „Frauen im Kirchenkampf 1933–1945“ ist der Grundstein für die 2003 von Christine Globig gegründete feministische Sozietät. Deren aktueller Verteiler erreicht etwa 200 Personen aus verschiedenen kirchlichen Berufsfeldern, theologisch Forschende und Studierende, die sich intergenerativ über wissenschaftliche Geschlechterforschung und aktuelle Forschungsprojekte vor Ort und in digitalen Treffen austauschen.
Feministische Theologie wurde von Anfang an von Studierenden eingefordert und auf deren Initiative auch im Lehrplan verankert. Im Wintersemester 1984/85 wurde ein Frauenreferat eingerichtet, 1988 der erste feministisch-theologische Lehrauftrag vergeben. Christine Reents wurde auf den Lehrstuhl für Praktische Theologie berufen und forschte zu „Religionspädagoginnen im 20. Jahrhundert“. 2002 wurde die Institutionalisierung durch eine „Dozentur für Feministische Theologie und theologische Frauenforschung“ vorangetrieben. 2009 wurde die Dozentur in eine W1-Juniorprofessur umgewandelt und 2020 mit dem W3-Lehrstuhl für Neues Testament und Theologische Geschlechterforschung zum ersten Mal ohne Befristung mit einer Professur verankert. Das 2022 an der KiHo offiziell eröffnete Institut für Feministische Theologie, Theologische Geschlechterforschung und soziale Vielfalt bündelt Veranstaltungen und bietet Literaturhinweise, Podcasts, einen eigenen Instagram-Account (gender.kiho.wuppertal) und die Möglichkeit, ein Zertifikat im Bereich Gender und Theologie zu erwerben.
Was bringt uns Theologische Geschlechterforschung?
Was verloren geht… Geschichte und Tradition, ein jahrzehntelanges Engagement ist in Zeiten knapper Kassen kein Argument für den Erhalt einer Einrichtung. Was bringt uns Theologische Geschlechterforschung? So wird oft aus einer eher wissenschaftsfernen Haltung heraus gefragt. Das ist berechtigt und muss erklärt werden. Sie leistet auf verschiedenen Ebenen „Übersetzungsarbeit“: aus den aufgrund ihrer komplexen Fachsprache oft schwer verständlichen Gender-Studies in die Theologie, aus den internationalen Diskussionen in den deutschen Kontext und schließlich aus der Genderperspektive in die einzelnen theologischen Fächer – und von da aus in die kirchliche Praxis. Wurde Gott in der Bibel bereits weiblich gedacht? Oder sogar queer? Ist es eigentlich angemessen, in der Liturgie Gott ausschließlich als „Herr“ anzureden? In der Theologie geht es immer auch um die Menschen. Ist in der Schöpfungsgeschichte nur von zwei Geschlechtern die Rede oder auch von allen, die zwischen männlich und weiblich anzusiedeln sind? Bietet das Neue Testament Strategien gegen die Macht toxischer Männlichkeit? Und noch umfassender gefragt: Was bedeuten Geschlechterfragen für die Entstehung und Geschichte des Christentums? Wie wurde in den verschiedenen Epochen Männlichkeit konstruiert? Und warum hat es seit der Reformation fast 500 Jahre bis zur Frauenordination gedauert?
Um diese Fragen zu beantworten, braucht es wissenschaftlich qualifizierte unabhängige Forschung, die kompetent die verschiedenen Diskurse intersektional miteinander verbindet und auf gut verständliche Weise in der Lehre verarbeitet. Zukünftige Pfarrpersonen müssen und wollen in gesellschaftlich wichtigen Fragen theologisch auskunftsfähig sein. In Wuppertal werden sie zukünftig keine eigenen Antworten mehr entwickeln können.
Claudia Janssen ist Professorin für Neues Testament und Theologische Geschlechterforschung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Sie ist Mitherausgeberin der Bibel in gerechter Sprache und forscht mit einer intersektionalen feministischen Perspektive.
Literatur
Korenhof, Mieke / Globig, Christine, Wuppertal, in: Feministische Theologie. Initiativen, Kirchen, Universitäten – eine Erfolgsgeschichte, Matthiae, Gisela / Jost, Renate / Janssen, Claudia / Mehlhorn, Annette / Röckemann, Antje (Hg.), Gütersloh 2008, 261-263.
Janssen, Claudia, Biographische Standortbestimmung und Perspektiven Feministischer Exegese, in: Perspektiven Feministischer Theologie und Gender Studies, FS für Renate Jost, Cornelia Schlarb u.a. (Hg.) Berlin 2021, 17-26.
Beitragsbild: KiHo Wuppertal