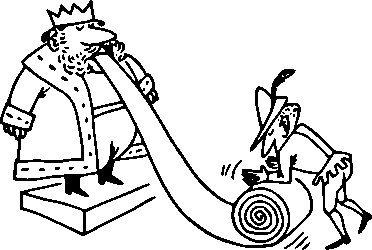Zum 50. Mal jährt sich 2021 der Todestag der Dichterin Gertrud von le Fort (11.10.1876 – 01.11.1971). Zwar lassen sich zahlreiche ihrer Novellen in Insel-Ausgaben auf Antik- und Flohmärkten finden, dazu gibt es immer wieder die ein oder andere Neuauflage – doch es ist still geworden um sie. Zu Unrecht meint Andreas Matena.
Ihre Figuren: antiquiert und symbolistisch angelegt; Sprache und Handlung ihrer Erzählungen: feierlich, metaphysisch, spätromantisch fern; ihr Katholizismus: vorkonziliar und triumphalistisch. Gertrud von le Fort erscheint gleich doppelt als Vertreterin untergangener Welten, als Dichterin eines Katholizismus, den es lange nicht mehr gibt ebenso wie als Bürgerin einer „Welt von gestern“ (Stefan Zweig). Schon ihr Zeitgenosse Thomas Mann gab seiner Rosalie von Tümmler in der Erzählung „Die Betrogene“ (1953) die Züge der le Fort und machte damit seine Figur, wie auch ihre Vorlage, die mit Mann beinahe gleichaltrige le Fort, zum Gestaltsymbol einer zu Ende gegangenen Epoche. Während Manns Werke noch heute als Beiträge zum Kulturverfall gelesen werden, erlebten le Forts Werke vor allem eine innerkatholische Rezeption, und dann die weitgehende Vergessenheit.
Ihre Bücher sollten auf den Index.
Doch der Schein trügt. Klingen ihre Werke mit Titeln wie „Hymnen an die Kirche“ nach heiler katholischer Welt, löste die le Fort bereits zu Lebzeiten heftige Kontroversen aus. Ihr zweibändiges Romanwerk „Der römische Brunnen“ („Das Schweißtuch der Veronika“, „Der Kranz der Engel“) wurde innerkatholisch heftig kritisiert, es gab sogar Bemühungen, das Buch auf den damals noch halbwegs relevanten Index der verbotenen Bücher setzen zu lassen. Man warf ihr eine falsche Ehelehre, nämlich die Rechtfertigung der wilden Ehe ebenso wie andere dogmatische Irrtümer, vor. Es wird berichtet, dass katholische Frauen das Buch nach der Lektüre entrüstet zurückgebracht hätten. Namhafte Theologen wie Erich Przywara, Alois Dempf und Hubert Jedin verteidigten die Dichterin gegen ihre Kritiker:innen, doch verlief der Diskurs binnenkatholisch.
Niemand geringeres als der 2019 verstorbene Literaturwissenschaftler Wolfgang Frühwald zeigte sich irritiert von diesem Umstand. Er hielt le Forts Erzählungen für durchaus vergleichbar mit dem Mann’schen „Doktor Faustus“ und bemängelte, dass le Forts Roman nie eingehend diskutiert worden ist. Im Grunde behandelt Gertrud von le Fort die gleichen Themen wie ihre zeitgleich schreibenden Kollegen: Dekadenz, Kulturverfall, Schuld, Bewältigung u.v.m. Sie hat thematisch die Auseinandersetzung mit jenen gesucht, diese aber nicht mit ihr. Im kritischen Gesellschaftsdiskurs ab den späten sechziger Jahren konnte ihre Stimme nicht mehr durchdringen. Dabei lesen sowohl Wolfgang Frühwald als auch der Theologe Eugen Biser ihre Geschichten sogar in Konvergenz mit dem Anliegen der kritischen Theorie, den Opfern von Gewalt eine Stimme zu geben.
Was bleibt, wenn das Sichtbare des Glaubens, die Kirche, zerstört wäre?
Gertrud von le Forts Zeitanalyse setzen mit den frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts ein. Unruhe, Verfall, Zerstörung und Krieg bilden den Hintergrund der meisten Werke, im Nachhinein wollte die le Fort ein Werk wie „Die letzte am Schafott“ (1931), welches die größte öffentliche Wirkung erzielte, sogar als Vorwegnahme des nationalsozialistischen Terrors verstanden wissen. Sie war sich bewusst, in einer Zeit zu leben, „die sogar Kinder mordet“ (Das Gericht des Meeres, 1943). Man wundert sich, dass ihre Werke die Zensur des Dritten Reiches passierten, derart offensichtlich erscheinen die Anspielungen. Möglicherweise war es das Gewand scheinbar historischer Erzählungen, welche das Werk der Dichterin zwar schützte, zugleich aber ihre Rezeption im Nachkriegsdeutschland erschwerte. Das geschichtlich auftretende Böse galt ihr als Verkörperung eines metaphysisch Dämonischen, ohne dass dadurch das Thema individueller Schuld und Verantwortung verharmlost worden wäre. Was die le Fort angesichts ihrer Zeit hingegen umtrieb, war die Frage nach einer unsichtbaren Wirklichkeit, die bestehen bleibt, wenn das Sichtbare des Glaubens, die Kirche, zerstört wäre.
Man kann nicht bestreiten, dass die Konvertitin Gertrud von le Fort ihre Werke von einem dezidiert katholischen Standpunkt aus anging. Doch gab sie sich dabei nicht der Illusion einer heilen kirchlichen Welt hin. Im Gegenteil. Die Erlebnisse der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschlands wie auch ihre theologisch-akademischen Vorprägungen durch Ernst Troeltsch und Friedrich Gogarten ließen sie zu dem Schluss kommen, in der „Abendröte des Christentums“ zu leben. Man könne zwar, so le Fort, „noch von einer großen Abendröte leben“ – die Sonne des Christentums sei aber bereits untergegangen und ungewiss sei, ob sie noch einmal wieder scheinen würde. Innerhalb nur einer Generation habe sich die Welt radikal verändert. In ikonoklastischem Duktus meint sie gar, dass „alle unsere Bilder zernichtet worden“ seien. Wie Sterne habe sie sie vom Himmel fallen sehen; geblieben sei nichts als Wüste, schreibt sie in Worten, die an die spanischen Mystiker:innen ebenso erinnern wie an Mutter Teresas Aufzeichnungen.
Die Liebe ist es, welche hoffen darf, die Dinge auf Gott hin transparent zu machen.
Das Werk der Gertrud von le Fort fragt danach, wie sich das Christentum in der Zeit seiner Abendröte einer autonom gewordenen Welt mitteilen kann, die sich ihres Symbol-, ihres Verweischarakters entweder nicht bewusst ist oder sich diesem sogar bewusst verweigert. Ihre schlichte Antwort: durch die Liebe. Die Liebe ist es, welche hoffen darf, die Dinge auf Gott hin transparent zu machen, so die Welt infrage stellt und sie in ihrer scheinautonomen Bindungslosigkeit zu entlarven sucht. Die Liebe, von der le Fort spricht, ist allerdings eine solche, die sich auf ihr Ziel hin auch bis aufs Äußerste enteignen muss. Ein Triumph dieser Liebe ist durch nichts gesichert, vom Automatismus einer Bekehrung der „Welt“ nirgendwo die Rede. Das Liebesopfer hinterlässt im Liebenden dafür umso sicherer Verwüstungen und abgrundtiefe Verlassenheit (vgl. H.U.v. Balthasars kenotische Theologie). Sicherheit und Kausalität haben in diesem denken keinen Platz mehr, eröffnen damit aber in der äußersten Liebe zum Menschen potentiell den Ort für einen Gott „der wirklich etwas zu sagen hätte“.
Es dürfte daher auch nicht von ungefähr kommen, dass Hermann Hesse sie 1949 für den Literaturnobelpreis vorschlug; dass man ihr die Ehrenpromotion der Theologischen Fakultät München verlieh; dass ihre Werke von Verlagen in ganz Europa, in Nord- und Südamerika, in Japan wie in Korea gedruckt wurden. Sie hat die radikalen Umbrüche ihrer Zeit früh und hellsichtig gesehen und mit den Mitteln der Dichtung dargestellt und versucht, ihnen von einem gläubigen Standpunkt aus so zu begegnen, wie es ihr angesichts der Katastrophen des 20. Jahrhunderts möglich und angemessen erschien. In der Zeit der „Abendröte“ des Christentums erschien die selbstlose, sich völlig hingebende und entäußernde Liebe als der einzige Weg, selbst wenn diese scheinbar der Lehre der Kirche zuwiderlief: „Im Jüngsten Gericht wird man nicht nach der Rechtgläubigkeit fragen, sondern nach der Liebe und der Barmherzigkeit.“ Gertrud von le Fort hat, mit den Worten David Tracys, das Zeug zu einem „Klassiker“ modernen Christentums, der weiterhin zu denken gibt.
Text: Dr. theol. Andreas Matena, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Fundamentaltheologie, Universität Augsburg.
Bild: Benzinger-Verlag, Patmos-Verlag