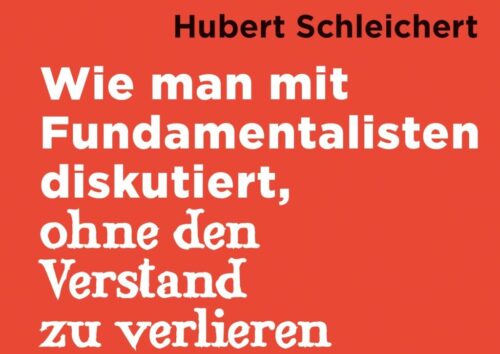Um besser zu verstehen, wie die oft anstrengenden Debatten mit Populist:innen funktionieren, hat Christian Cebulj wieder einmal Hubert Schleicherts Band „Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren“ zur Hand genommen. Daraus ist ein Plädoyer für eine politisch sensible Theologie und Religionspädagogik entstanden.
Während ich diese Zeilen formuliere, ist die Welt in Aufruhr. Rechte Populist:innen, radikale Nationalist:innen bestimmen in unsicheren Zeiten den politischen Takt. Der Ukrainekrieg geht nächste Woche in sein drittes Jahr. Die USA haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz begonnen an der bestehenden Weltordnung zu rütteln und hinterlassen ein verstörtes Europa. Nach Aschaffenburg, Magdeburg und München ereignete sich auch im österreichischen Villach ein islamistischer Anschlag, der die üblichen Forderungen nach Abschottung und Grenzkontrollen zur Folge hat.
Das ‚Schon‘ des Reiches Gottes muss sich in der Gegenwart sichtbar machen.
In Deutschland war der Wahlkampf selten so geprägt von einer Spannung zwischen Progression und Regression, die wir ja nicht nur in der Politik, sondern auch in unserer Theologie und Kirche erleben. Sie bringt die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Politik ins Spiel, die ich angesichts der aktuellen Konflikte auch als Auftrag für eine politisch sensible Religionspädagogik verstehe. Wenn wir im Markusevangelium 1,14ff. vom anbrechenden Reich Gottes hören, dann müssen es gerade die empirisch wahrnehmbaren politischen Kontexte der Gegenwart sein, in denen sich nicht nur das theologische ‚Noch nicht‘, sondern auch das ‚Schon‘ des Reiches Gottes sichtbar macht, das eine Ahnung vom Frieden oder wenigstens die Hoffnung darauf ins Wort bringt.
Im Kontext der Frage nach dem Verhältnis von Progression und Regression lohnt der Blick auf die politisch klare, aber in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommene Erklärung der Deutschen Bischöfe, die sich bereits 2024, aber jetzt erneut und klar, für die Nichtwählbarkeit der AfD bei der anstehenden Bundestagswahl in Deutschland ausgesprochen haben. Die Bischöfe beklagen in ihrem Papier, dass die Konzentration auf das kulturell homogen gedachte eigene Volk notwendig mit einer Verengung des Solidaritätsprinzips einhergeht, das in der katholischen Soziallehre zentrale Bedeutung hat und eine Leitidee der deutschen Verfassung darstellt.
Rechtsextreme verlangen dagegen nach einem ‚Sozialpatriotismus‘, mit dem sie die Solidarität innerhalb des völkisch-national verstandenen Volkes meinen.1 Daneben lässt sich eine Strategie rechtspopulistischer Kreise erkennen, die sich gern auf das christliche Erbe des ‚Abendlands‘ berufen, das es gegen vermeintlich ‚Fremdgläubige‘ zu verteidigen gilt. Rechte Parteien überall in Europa finden darin eine perfekte Schablone, mit der sich trefflich identitäre Rhetorik betreiben lässt.2
Elementarisieren ohne zu banalisieren.
Für eine politisch sensible Religionspädagogik bedeuten die hier skizzierten Debatten, dass sie aus der Spannung zwischen Progression und Regression, sowie aus der Konfrontation mit postfaktischer Meinungsbildung verändert hervorgehen muss: aufgeklärter, selbstkritischer, demokratischer, verantwortungsvoller, wirklichkeitsnäher und mit einer noch deutlicheren Absage an menschenverachtende Ideologien. Für eine politisch denkende Religionspädagogik ist auch interessant, dass die Diskussionen in den Parlamenten um die Wahrheit bzw. die Wahrheiten zuhauf Anknüpfungspunkte an verschiedene unserer Fachdebatten um den Bildungsbegriff enthalten.3
Wer mit den Realitäten religiöser Bildung und kirchlicher Verkündigung in Religionsunterricht, Katechese, Erwachsenenbildung, Liturgie und Seelsorge zu tun hat, steht immer wieder vor der Herausforderung, zentrale Glaubensinhalte in eine verständliche Sprache übersetzen zu müssen. Nach dem Prinzip „Was wahr ist, muss auch leicht zu sagen sein“ hat es sich das seit Jahrzehnten bewährte Elementarisierungs-Modell (nach Karl-Ernst Nipkow und Friedrich Schweitzer) zur Aufgabe gemacht, Glaubensinhalte auf ihre Kernbedeutung zu reduzieren, ohne sie aber zu banalisieren. Wie oft wäre das auch in politischen Debatten hilfreich!
Im Moment habe ich allerdings eher den Eindruck, dass der Anspruch des Elementarisierens ohne zu banalisieren für Populist:innen und Fundamentalist:innen gerade kein Kriterium der Argumentation ist. Um besser zu verstehen, wie die oft anstrengenden Debatten mit ihnen funktionieren, habe ich wieder einmal Hubert Schleicherts Band „Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren“ (München, 11. Aufl. 2022) zur Hand genommen. Geistvoll und bissig entlarvt der Wiener Philosoph anhand zahlreicher Beispiele die rhetorischen und argumentativen Tricks von Populist:innen und Fundamentalist:innen jeder Couleur. Er zeigt, wie man die Schwachstellen ihrer Diskussionsweisen und Weltanschauungen nutzt, um in Streitgesprächen besser zu bestehen. Ein im besten Sinne aufklärerisches Buch, ein Lesevergnügen in Logik und Argumentationskunst. Schleichert nennt u.a. drei Merkmale von Fundamentalismus, die mir wie das Gegenbild zu einer Theologie vorkommen, die sich in ihrer Suche nach der Wahrheit auf robuste Fakten, auf vernünftige Argumente und auf elementare Aussagen stützt:
1.) Fundamentalisten suchen in Politik, Gesellschaft und Glauben nach eindeutigen Antworten. Je unübersichtlicher die Lebenswelt wird, desto mehr wächst ihr Bedürfnis nach sicherem Halt. Und weil nicht nur Welt und Gesellschaft, sondern auch Religionen, Kirchen und Konfessionen immer komplexer werden, haben religiöse Fundamentalist:innen überall Hochkonjunktur.
2.) Fundamentalisten suchen die Schuld für all das, was in ihrer Sicht falsch läuft, bei ‚den Anderen‘. Populist:innen und Fundamentalist:innen teilen die Welt in ein ‚wir‘ und ein ‚die‘. Die Logik der Populist:innen funktioniert so, dass sie sich für die wahren Volksvertreter:innen ausgeben, die Fundamentalist:innen für die wahren Vertreter:innen einer Religion oder Konfession. Dabei sind ‚die Anderen‘, nicht zuletzt die je anderen Fundamentalist:innen.
3.) Fundamentalisten haben Probleme mit dem Humor. Im berühmten Satz des Journalisten Otto Julius Bierbaum: ‚Humor ist, wenn man trotzdem lacht‘ deutet das ‚trotzdem‘ auf einen Riss zwischen Wunsch und Wirklichkeit hin. Wer trotzdem lacht, nimmt diesen Riss wahr. Darin liegt die totalitätskritische und subversive Kraft des Humors, denn der Humor stellt sich dem, was nicht aufgeht. „Wer über eine Sache lacht, hat keine Angst mehr vor ihr“, betont auch Hubert Schleichert.4 Eine vernunftbasierte Theologie und eine politisch sensible Religionspädagogik sollten deshalb im Umgang mit Populist:innen und Fundamentalist:innen nie den Humor verlieren, auch wenn meine Erfahrung ist, dass ideologische Gesprächspartner:innen in wesentlichen Streitfragen überhaupt keinen Spaß verstehen.
Das Christentum noch stärker als bisher als Bildungsreligion profilieren.
Ich meine, dass Theologie und Religionspädagogik die Spannungen zwischen Progression und Regression künftig am besten dadurch in eine Balance bringen werden, indem sie das Christentum noch stärker als bisher als Bildungsreligion profilieren. Das Christentum war immer und ist bis heute eine Bildungsreligion. Zwar ist das Christentum eines nicht: eine Religion nur für Gebildete. Aber es ist eine Religion, die auf Bildung setzt, und das aus gutem Grund.5
Kürzlich sprach der Münchner Soziologe Armin Nassehi auf dem Katholisch-Theologischen Fakultätentag über die gesellschaftliche Bedeutung der Theologie. Dabei stellte er die interessante systemtheoretisch begründete Frage: Wie lautet eigentlich das Problem, auf welches die Theologie eine Antwort hat? Diese Frage sorgte in den Reihen der anwesenden Kolleg:innen für lebhafte Gespräche und Antwortversuche. Nassehi betonte im Sinne eines soziologischen Antwortvorschlags, dass der entscheidende Punkt die nach wie vor relevante und signifikante Existenz einer vielfältigen religiösen Praxis sei. Solange es in Deutschland, Europa und weltweit religiöse Praxis gebe, brauche es auch eine akademische Theologie, welche die Reflexion dieser Praxis übernimmt, so Nassehi.
Daraus leitet sich der Anspruch einer politisch sensiblen Religionspädagogik ab: Gegenläufig zu den massenhaften Kirchenaustritten, zu den abnehmenden Studierendenzahlen und zur sinkenden Bedeutung des Religionsunterrichts spielt die Profilierung des Christentums als Bildungsreligion eine wichtigere Rolle denn je. Bei der Spannung aus Progression und Regression geht es ja nicht primär um die Frage von konservativ und progressiv. Nichts muss so bleiben, weil es immer so war. Nichts muss geändert werden, weil es ‚in‘ ist, alles zu ändern.
Es geht vielmehr darum, eine politisch sensible Theologie und Religionspädagogik in einer Kirche zu treiben, die sich illusionslos auf die Bedingungen einer offenen Gesellschaft der reflexiven Moderne einlässt und ihren Bildungsauftrag verstärkt wahrnimmt. Wenn sie dabei nicht den Verstand verliert, ist zu erwarten, dass sie auch in Zukunft eine starke und nachhaltige Alternative zu Populismus und Fundamentalismus sein wird.6
___

Christian Cebulj ist Professor für Religionspädagogik und Katechetik an der Theologischen Hochschule Chur (Schweiz) und Leiter des Forschungsprojekts „Religion-Kultur-Tourismus“.
Bild: Ausschnitt Buchcover, Hubert Schleichert, Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren, Verlag C.H.Beck.
- Vgl. Deutsche Bischofskonferenz: Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar (22.02.2024), verfügbar unter: https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2024/2024-023a-Anlage1-Pressebericht-Erklaerung-der-deutschen-Bischoefe.pdf. ↩
- Vgl. Christian Cebulj: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Religionspädagogische Thesen zum Christentum als Bildungsreligion, in: Ruhstorfer, Karlheinz (Hg.): Zwischen Progression und Regression. Der Weg der Katholischen Kirche, Freiburg i. Br. 2019, 226-242. ↩
- Vgl. Christian Cebulj: Fundamental statt fundamentalistisch. Religiöse Bildung als politische Bildung, in: Arnd Bünker u.a. (Hg.): Anders.Bildung.Kirche. Eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft Praktische Theologie Schweiz, St. Gallen 2022, 139-150. ↩
- Schleichert, Fundamentalisten 151. ↩
- Vgl. dazu auch Thomas Söding, Das Christentum als Bildungsreligion. Der Impuls des Neuen Testaments, Freiburg 2016. ↩
- Die vorliegenden Thesen wurden am 15.02.2025 als Input auf der 43. Rhein-Main-Tagung der Religionspädagoginnen und -pädagogen in Mainz vorgetragen. ↩