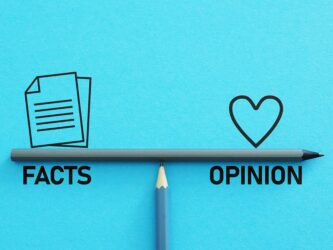In seinem Theaterstück „Familie“ bringt der Genter Regisseur Milo Rau den Suizid einer Familie auf die Bühne. Es ist das gewählte Lebensende der Familie Demeester, eines Ehepaars und seiner jungen, erwachsenen Töchter. Es ist vor allem das fehlende, nicht erkennbare Motiv der Tat, das 2007 für Aufsehen sorgte. Wolfgang Beck wirft den Blick auf Hintergründe des Theaterstückes, das in Deutschland in die neue Diskussion um Sterbehilfe und Fragen des Selbstbestimmungsrechtes trifft.
Alles ist gut. Alles scheint geordnet zu laufen. Es ist das Leben in einem gepflegten Eigenheim. Eine glückliche Ehe. Erfolg im Beruf. Die Töchter im Internat. Die Freude am Kochen, an den Haustieren, an den Urlauben. Es ist das Leben der Familie Peeters/Miller, die sich selbst und ihr Leben spielt. Der Regisseur Milo Rau (MR) gibt mit seinem Stück „Familie“ den Blick in das alltägliche Leben einer Familie frei, in der alles wohl geordnet erscheint. Die Zuschauer*innen können durch die Scheiben des adretten Hauses schauen. Da wird geduscht, für die Schule gelernt, das Abendessen vorbereitet. Alltägliches Leben, „durchschnittlich glücklich“ (Milo Rau).

Ein Abschiedsbrief:
Wir haben es vermasselt, sorry!
Erst nach und nach deutet sich an: dieser Abend der Familie ist gut geplant. Es ist ihr letzter Abend. Das Abendessen ist vom Vater, der vor seiner Karriere als Schauspieler Koch gelernt hat, aufwändig zubereitet. Und doch hat keiner richtigen Appetit. Als der Tisch abgeräumt und noch ein Video von früheren Urlauben angesehen ist, folgen in diesem Plan die schweren nächsten Schritte. Die Familie verpackt ihren Hausstand in Kisten, so als würde sie umziehen. Alles soll ordentlich sein, niemand soll später zu viel Arbeit haben. Dann wird die festliche Kleidung angezogen. Die Hocker werden bereitgestellt und die Schlingen an der Decke befestigt. Ein letztes Zögern, jedes Wort scheint zu viel. Für den Brief auf dem Tisch genügt das kurze Statement: „Wir haben es vermasselt, sorry“. Es ist ein „minimalistischer Abschiedsbrief“ (MR). Dann steigen alle auf die vier bereitstehenden Hocker, legen die Schlingen um, halten sich an den Händen und erhängen sich.
Die Unklarheit der Motive als Provokation
Die Familie Peeters/Miller spielt in der Alltäglichkeit sich selbst und in dem letzten Abend zugleich eine reale Familie: In einem Haus im französischen Calais wurde im Jahr 2007 die Familie Demeester nach ihrem Kollektivsuizid gefunden. Erhängt in einem aufgeräumten, ordentlichen Haus. Milo Rau greift diese reale Begebenheit in seinem Stück auf und ordnet sie als letztes Element in eine Trilogie ein. In zwei vorausgegangenen Stücken hatte er bereits Gewalttaten zum Belgischen Kindermörder Dutroux in dem Stück „Five Easy Pieces“ und den Mord an einem Homosexuellen in dem Stück „Die Wiederholung“ thematisiert. Mit dem kollektiven Suizid der Familie wird unklar und un-ein-deutig, wo Verbrechen beginnen und wie Schuld und Verantwortung exakt abzugrenzen wären.

Das „Normale“ eines toxischen Gesellschaftskonzeptes
Milo Rau zeigt die Situation der Familie an ihrem letzten Abend bis zum schwer erträglichen Schluss. Keine Gewalteinwirkung, kein Verbrechen. Vor allem aber: kein für Außenstehende erkennbares Motiv! Es scheint ein gutes, bürgerliches, vielleicht etwas zu geordnetes Leben zu sein. Es ist ein Leben, das als idealtypisch für die moderne bürgerliche Mittelschicht in Westeuropa gelten kann. Das heißt auch: Es wird zu viel konsumiert, zu viel gereist, zu viel geplant. „Sie leben auf Kosten der künftigen Generationen und natürlich auf Kosten der Dritten Welt“ (MR) – mit dieser Analyse des vermeintlich Normalen benennt der Regisseur die prekäre, die suizidale Struktur eines Gesellschaftsmodells.
Alles wird Bestandteil einer Konstruktion meiner Identität
Doch es ist nicht nur das Konsumverhalten, an das sich alle gewöhnt haben und das doch als toxisches Lebenskonzept zu entlarven ist. Es ist vielmehr ein Menschenbild, das hier ausgedrückt wird. Darin werden alle Träume und Wünsche zum Bestandteil einer Identitätskonstruktion. Es ist die perfekt abgestimmte Präsentation des eigenen Idealbilds vom Leben. Milo Rau lässt die Geschichte der Familie Demeester von einer realen Familie darstellen, dem Ehepaar Peeters/Miller und seinen beiden Töchtern. Die Geschichte wird damit zur gesellschaftlichen Repräsentanz. Hier geht es nicht um einen spektakulären Sonderfall, der aufgrund der unklaren Motive mysteriös erscheint. Es geht um Strukturen gesellschaftlicher Idealbilder.
Der Ruf nach selbstbestimmtem Sterben
im Schmerz.
Das Theaterstück „Familie“ trifft in Deutschland in die neuerliche Debatte um die Ermöglichung des selbstbestimmten Sterbens. Die Richter*innen des Bundesverfassungsgerichtes betrachten die Entscheidung über den eigenen Tod als Bestandteil des persönlichen Selbstbestimmungsrechts. Deshalb ist Hilfe zur Selbsttötung zu leisten. Hinter der Entscheidung steht die Klage von Menschen mit unerträglich gewordenem Leid. Darin liegt ein zunächst ein zentraler Unterschied zum Theaterstück: Ihnen ist nicht die Normalität des Lebens zum Überdruss geworden und auch nicht das Banale der Konsumorientierung einer bürgerlichen Mittelstandsexistenz. Bei ihnen sind es der Schmerz, die Aussichtslosigkeit fortschreitender Krankheit, die Atemnot. Niemand wollte diesen Menschen absprechen, dass ihre Not verständlich ist. Ihre Gründe und Motive für den Ruf nach einem selbstbestimmten Sterben liegen auf der Hand und sind für viele nachvollziehbar. Und wohl niemand mag für sich selbst ausschließen, ob er oder sie in auswegloser Situation nicht ähnlich denken wird. Die Aussicht auf eine selbstbestimmte Beendigung des Lebens wird diesen Menschen zur Sehnsucht. Zugleich fällt auf, wie wenig in diesen Tagen nach dem Urteil von Karlsruhe von den stark verbesserten palliativmedizinischen Möglichkeiten gesprochen wird. Und darin werden dann doch Parallelen zwischen Theaterstück und der Not sterbenskranker Menschen erkennbar: Möglicherweise geht es weniger um den Suizid als letzten Ausweg für Menschen, denen nicht geholfen und deren Schmerzen nicht behandelt werden können. Es geht viel stärker um die individuelle Gestaltungshoheit über ausnahmslos alle Fragen des Lebens.
Nicht Ausweglosigkeit sondern Selbstbestimmungsrecht
Der Fokus liegt auch bei dem Urteil der Verfassungsrichter*innen auf der Übernahme einer Argumentationsstruktur, die seit langem im Umfeld humanistischer Verbände gepflegt wird: Der Suizid wird als selbstbestimmte Beendigung des Lebens und als Ausdruck der persönlichen Freiheit betrachtet. Die bewusst gestaltete und terminierte Beendigung des eigenen Lebens wird damit zum Bestandteil der Persönlichkeitsrechte. Die Übernahme dieser Vorstellung ist in vielfacher Hinsicht problematisch. Sie spiegelt eine gesellschaftliche Entwicklung, in der die Gestaltung aller Lebensphasen als persönliche Aufgabe und Gestaltungsmasse verstanden wird. Alles, von der Bildungsbiografie, gewählten Freizeitbeschäftigungen, der präferierte Kommunikationstechnik bis hin zur Bestattungsform für Angehörige soll zum Ausdruck der persönlichen Identitätskonstruktion werden. Dass nur das Ende des Lebens diesem Gestalten vorenthalten sein soll, erscheint da wenig plausibel.
Alles wird zur Aufgabe der Konstruktion
einer eigenen Identität
Alles unterliegt damit dem Gestaltungsdruck. Alles wird zur Entscheidung, die bewusst getroffen und mit dem Gesamtlebenskonzept in Übereinstimmung zu bringen ist. Alles gibt Auskunft darüber, wie ich mich verstehe. Natürlich gibt es dabei Überforderungserfahrungen. In diesem Verständnis steht das gesamte Leben unter der Aufgabenstellung eines bewussten Biografiedesigns und wird mit entsprechenden Narrativen begleitet. Im Zentrum dieser Narrative steht dogmenähnlich der Satz: Ich habe entschieden!
Die falsche Entscheidung als Unerträglichkeit
Diese Narrative können sogar verdecken, dass nicht alles Behauptete auch tatsächlich den eigenen Vorstellungen entspricht. Erfahrungen des Scheiterns müssen deshalb wenigstens als wichtiger Erfahrungsgewinn oder als besondere Herausforderung, die es zu bestehen galt, deklariert werden. Die expansive Möglichkeit zur Entscheidung enthält die quälende Einsicht, dass ich mich an entscheidenden Punkten auch falsch entscheide. Die Familie Peeters/Miller bekennt diese Fehler am letzten gemeinsamen Abend. Doch sie können nicht verziehen werden, sondern münden in das Demeester-Statement: „Wir haben es vermasselt, sorry.“ Es ist die dunkle Seite eines Lebens als Kette von Entscheidungsoptionen. Es erscheint paradox: Fehlentscheidungen werden unverzeihbar. Gar nicht entscheiden zu können wird zur Beleidigung.
Am Lebensende warten bittere Kränkungen
für das Ideal der Selbstbestimmung
Am deutlichsten wird dies für viele Menschen am Lebensende. Eine Mehrheit der Gesellschaft gibt bei Umfragen an, dass sie sich das Lebensende zuhause und im Kreis von Angehörigen wünscht. Doch die Diskrepanz zur Realität ist groß. Denn die meisten Menschen sterben in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Es ist eine große letzte Beleidigung der behaupteten und idealisierten Selbstbestimmung: Das Sterben läuft anders, als erhofft. Ausgerechnet das Finale entspricht nicht dem eigenen Ideal. Deshalb erscheint es plausibel, diesen Kränkungen aus dem Weg zu gehen, indem ich gerade noch rechtzeitig die Entscheidung für das eigene Lebensende treffe. Der Suizid entspricht daher vollkommen dem Lebenskonzept des Gestaltens einer Idealkonstruktion. Hier braucht es kein Motiv mehr, wie Milo Rau mit seinem Theaterstück und vorgestellten Banalität des Normalen zeigt. Es genügt der persönliche Eindruck, dass diese gewählte Form des Sterbens zum eigenen Selbstbild passt.
Nein, Selbstbestimmung ist nicht alles.
Genau deshalb ist es so fatal, dass das Bundesverfassungsgericht eine Chance verpasst hat, den Lebensschutz höher zu bewerten, als das Selbstbestimmungsrecht. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen und verhindert, dass eine Gesellschaft, die so stark auf die Inszenierung der eigenen Identitätskonstruktion ausgerichtet ist, eine markante Grenzziehung erlebt. Sie verhindert das klare Veto: Du hast nicht alles in der Hand! Das Selbstbestimmungsrecht der Einzelnen endet eben nicht nur an den Selbstbestimmungsrechten anderer Menschen. Es endet auch an höherstehenden Werten, vor allem dem Lebensschutz. Wem hingegen das Selbstbestimmungsrecht das höchste Gut ist, der wird selbst einen motivlosen Suizid als Frage des persönlichen Stils achselzuckend hinnehmen müssen. Wer hingegen das Leben nicht nur als Gestaltungsauftrag ansieht, sondern als unbedingt schützenswertes Gut, wird im selbstbestimmten Sterben sehen, was es ist: eine Tragödie. Tragödien aber sind nicht zu ermöglichen. Sie sind nach Kräften zu verhindern.
___
Autor: Wolfgang Beck, Mitglied der feinschwarz-Redaktion, Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik an der PTH Sankt Georgen, Frankfurt/M.
Das Theaterstück „Familie“ wird im März 2020 in der Schaubühne in Berlin gezeigt.
Foto: Stephan Bechert / unsplash.com