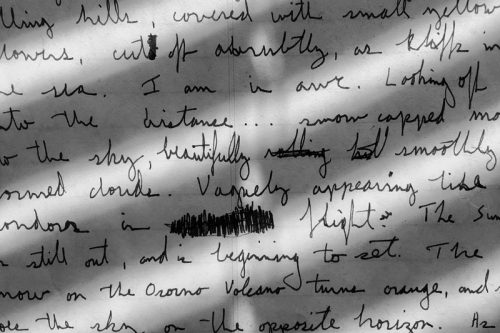Michael Köhlmeier schreibt über den Versuch und die Versuchung einer wahrheitsgetreuen Biographie. Clemens Kascholke schaut ihm (und sich) dabei über die Schulter.
Wie oft muss ich mich im Laufe eines Jahres fremden Personen vorstellen? Dreißigmal? Sechzigmal? Hundertmal? Am Ende eines Jahres weiß ich es oft nicht mehr. Inzwischen habe ich meinen persönlichen „Klappentext“ entworfen, wenn ich jemanden bspw. in einem Interview mein Leben vorstelle. Doch gänzlich frei bin ich da nicht. Ich bin genötigt, es mit meinen verschiedenen Aushängeschildern in den social media und der Öffentlichkeitsarbeit meines Ordens abzugleichen. Und weiß ich wirklich genau, was man über mich „herausfinden“ kann, wenn man lange genug sucht?
Mein persönlicher „Klappentext“
Wie unterschiedlich sich der Umgang mit der eigenen Biographie gestalten kann, das führt der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier (*1949) anschaulich in seinem Roman Abendland aus dem Jahr 2007 vor – auch indem er zahlreiche Anspielungen auf seine eigene Biographie hineinwebt.
Im Zentrum des Plots stehen zwei Männer, die zunächst unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen der hochbetagte Jazz-Fan Carl Jakob Candoris und zum anderen der frisch an der Prostata operierte Schriftsteller Sebastian Lukasser. Einer möchte vor seinem Tod sein Leben, seine Lebensgeschichte(n) erzählen und will vor allem, dass der andere diese erzählend zu Papier bringen wird. Unbekannt sind sie einander nicht – ganz im Gegenteil C.J.C. (so betitelt Sebastian Lukasser seine Notizhefte im Roman) ist generationenübergreifender „Schutzengel“ der Familie Lukasser.
Lügen
„Heute vor einem Jahr ist Carl gestorben. Ich erinnere mich – und das heißt wohl auch, ich lüge mir eine Ordnung in die Dinge.“ (AL 775)
So blickt Sebastian Lukasser auf die letzten Gespräche mit C.J.C. vor dessen Tod und das daran anschließende Jahr zurück. Die inzwischen stattgefundene, vielschichtige Beschäftigung mit dem eigenen und dem fremden biographischen Material hat ihn zu der Erkenntnis geführt, dass die Erinnerung bzw. das Erinnern eine konstruierte Ordnung der vergangenen Geschehnisse darstelle. Als Leser*in wird man nicht erst am Ende des Romans vor die Frage der Ordnung der Dinge und den darin geflochtenen Lügen konfrontiert. Denn die Grenzen zwischen bekannten historischen Fakten des 20. Jahrhunderts, möglichen Geschehnissen darin und literarischer Fiktion verwischt und umspielt Köhlmeier geschickt.
Die Dinge des (eigenen) Lebens klar und stimmig zu ordnen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Was mit den Höhlenmalereien begonnen hatte, setzte sich über die mythischen Erzählungen der ersten Hochkulturen fort und fand seinen Höhepunkt in den Versuchen Universalgeschichten zu verfassen. Auf der individuellen Ebene findet es gegenwärtig seinen Ausdruck in der Präsentation des eigenen Lebens in den sozialen Netzwerken über posts und shares. Wenn man versucht, in allen Dingen eine Ordnung von linearen Zusammenhängen zu entdecken, dann wird man zwangsläufig in die Falle der Lüge hineintappen müssen.
„Die Vergangenheit ist der Laden des Teufels […] und der Teufel liefert jede Ware, die gewünscht wird; was ja wohl heißen soll, dass Erinnerungen immer lügen, weil sie aus dem Fundus des Lügenkönigs stammen.“ (AL 223)
Komponieren
Trotz der möglichen Falle des „(un)bewussten Lügens“, des Glättens und des Auslassens eröffnet sich ein Zugriff auf die eigene Biographie nur durch das eigene Erinnern oder die erinnernden Erzählungen anderer Menschen, mit denen man dieselben Begebenheiten geteilt hat. Notgedrungen wird man so zum Erzähler seiner eigenen Biographie, die rein objektiver Kriterien nicht standhalten kann – und auch nicht muss. Sondern allein die persönliche Erzählung dient als selbstdefinierender Maßstab:
„Nicht die Begebenheit, gleichgültig, ob schwerwiegend oder nebensächlich […] entscheide über Tiefe und Weite des Raumes in der Vergangenheit, der erzählend mit Sinn erfüllt wird, sondern die Frage, wie viele andere Begebenheiten, also: wie viel Welt diese eine Begebenheit unter ihr Diktat zwinge.“ (AL 183)
Zwar schlägt Abendland ein Panorama über das gesamte 20. Jahrhundert und bindet historische Ereignisse mehrerer Kontinente zusammen, aber die literarischen Figuren in Abendland werden oft in kleinen, alltäglichen Situationen gezeigt. Die meisten Handlungen entfalten keine Dynamik eines formal weltverändernden Ereignisses, aber auf der persönlichen Ebene, in der persönlichen, biographischen Erzählung können sie eine entscheidende Weichenstellung gewesen sein.
So wird man als Leser*in über das ganze Buch hinweg nicht umhinkommen und immer wieder darauf gestoßen, sich der eigenen Muster des Erzählens bewusst zu werden. Welche – scheinbar-unscheinbaren – Wegpunkte meines Lebens waren so bedeutend, dass sie meine Welt unter ihr Diktat gezwungen haben? Welche Komposition – welche Zusammenfügung – gebe ich meinem Leben?
Reflektieren
Nicht nur C.J.C. und Sebastian Lukasser erinnern sich immer wieder in unterschiedlicher Form für sich und für einander, sondern auch zahlreiche andere Figuren des Romans werden in ihrem Erinnern geschildert oder reflektieren darüber. Dabei lässt Köhlmeier seine Figuren immer wieder an sich selbst zweifeln. Lässt sie ihre Vergangenheit von einer neuen Gegenwart aus betrachten. Lässt sie Entscheidungen hinterfragen und neu bewerten. In Abendland erscheint die Gegenwart für die agierenden Figuren als sich immer wieder entziehender Moment der Improvisation – mit Motiven ihrer eigenen Vergangenheit.
„Ich habe mich nicht getraut. Ich stand an der Peripetie meines Lebens. Das wusste ich. Und weil ich es wusste, habe ich mich nicht getraut, mein Leben so gründlich zu ändern, wie es der neue Weg verlangt hätte. Also bin ich ein paar Schritte zurückgetreten und habe meine Reise auf einem der alten Wege fortgesetzt.“ (AL 182)
Im Reflektieren, in der bewussten Besinnung auf die Eingebundenheit in unsere Vergangenheit und unserer Erinnerung eröffnet sich für uns Menschen der Moment jener flüchtigen Freiheit, gestaltend und nicht gestaltet Wege in die Zukunft hineinzusetzen. Damit soll sich nicht der Illusion hingegeben werden, dass unsere menschliche Freiheit eine absolute sei. Auch unsere Fähigkeit zur Reflexion ist von unserer Vergangenheit und unserem Erinnern geprägt. Unsere Freiheit ist immer eine relative. Relativ zu dem, was uns in das Gesamt der Welt- und Menschheitsgeschichte einbindet.
„Die Erinnerung formt sich nach den Folgen des Erinnerten; der Phantasie liegt ein stabiles gegenwärtiges Verlangen zugrunde, nämlich: sich einzubilden, wer man in der Vergangenheit hätte gewesen sein können; und trotz aller Vorsicht, nur ja nicht Wirklichkeit und Wunsch zu verwechseln, streckt sich das Fragezeichen des Konjunktivs allmählich zum Rufzeichen des Indikativs, so dass das Erinnerte bald alles andere als ein Bild aus der Vergangenheit darstellt, sondern nur noch die Nöte der Gegenwart spiegelt.“ (AL 223)
Menschen leben nicht nur aus, sondern auch von ihren Erinnerungen, das zeigt sich besonders dann, wenn Krankheit oder Alter den Zugriff darauf erschweren oder sogar unmöglich machen. Dabei dürfen die eigenen Unzulänglichkeiten des „Lügens“ und „Komponierens“ nicht entmutigen. Denn eine zwangsläufige Determinierung ergibt sich daraus nicht.
Vielleicht ist es das, was man als Leser*in von C.J.C. und Sebastian Lukasser lernen kann: Im Moment der Reflexion eröffnet sich eine Freiheit, die den Blick zurück in einen Blick nach vorn in die noch ungeschriebene Biographie hinein umschwingen lassen kann. Wie klein und bedeutungslos diese Freiheit auch erscheinen mag, sie bedeutet Freiheit.
So bietet mir vielleicht im nächsten Interview die aufmerksame Frage meines Gegenübers die Chance aus den gewohnten Bahnen meines „Klappentextes“ auszubrechen. Einen neuen Blick auf meine Geschichte durch die Augen eines Anderen zu erhalten und mich auf diese Weise besser zu verstehen.
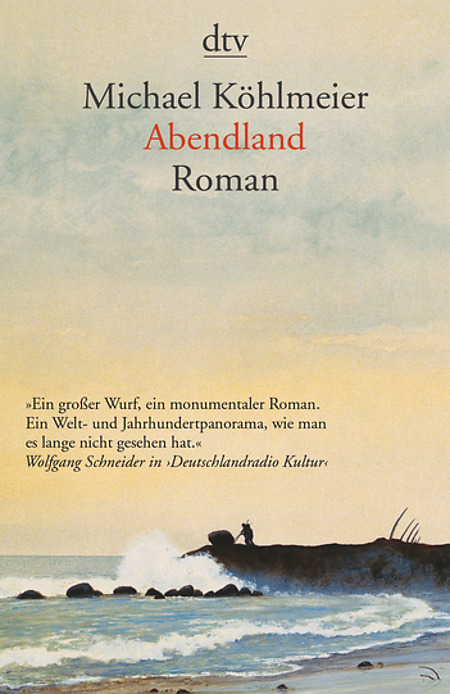
—
Clemens Kascholke ist Jesuit und absolviert derzeit an der LMU München ein Aufbaustudium für Lehramt an Gymnasien mit den Fächern Deutsch und Religion.
Beitragsbild: micah-boswell-unsplash; Cover: Abendland