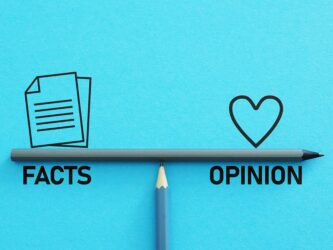Hilfsgütertransporte und Willkommenskultur genügen nicht, um der Herausforderung des Ukrainekrieges gerecht zu werden. Es braucht ein neues Sozialethos unserer politischen Existenz. Wir können es uns nicht leisten, keine Held:innen sein zu wollen. Eine Standortbestimmung von Daniel Bogner.
Der deutsche Kanzler hat ein Wort geprägt. In kleinen Dosen sickert ein, was das heißen mag, Zeitenwende. Jeden Tag ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer. Und es hat eine Wirkung, die schwindelig macht. Weil spürbar wird: Es geht um mehr als um neue Prioritäten im Nationalbudget. Die Koordinaten meiner, unserer Existenz als Bürger:innen und Bewohner:innen dieses Kontinents werden künftig andere sein als bisher. Wo standen wir noch vor kurzem?
Ich erinnere mich an mein 12. Schuljahr. Es war nicht lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Zu meiner Musterung in Regensburg fuhr ich mit dem Gefühl: Wer heute zur Bundeswehr geht, der wird niemals in einen realen Krieg ziehen müssen. Entsprechend waren die einen auf Ausschau nach interessanten Einsatzorten, etwa im Heeresmusikcorps oder bei den Abhörern, wo sie Tschechisch und Russisch lernen durften. Und die anderen traten den Zivildienst an, begleitet vom Rat unserer Gemeindereferentin, dass einen das in der persönlichen Entwicklung weiter voran brächte als der Wehrdienst.
Das Ende vom Ende der Geschichte
Beide Male ist es ein ähnliches motivationales Muster: Man darf auf sich schauen, weil das große Ganze keine unmittelbaren Sorgen bereitet. Mit dem Fall der Mauer und dem «Ende der Blockkonfrontation», wie es in der Politolog:innenprosa der Nachwendezeit so schön hieß, wurde das Schema dann besiegelt: Ende der Geschichte! Es gibt keinen Systemkonflikt mehr, und deswegen gehören auch die großen Kriege der Vergangenheit an. Was jetzt noch kommt, sind Randgefechte mit den Nachzüglern der historischen Entwicklung (Regionalkonflikte in Afrika), und eben Aufräumarbeiten (das wirtschaftliche Aufholen der ehemaligen Ostblockländer). Ansonsten leben wir im «gemeinsamen Haus Europa» (Kohl-Gobatschow), wir gehen fair und regelgeleitet miteinander um. Die Dividende des KSZE-Helsinki-Prozesses konnte eingefahren werden –- Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, grenzenloser Reiseverkehr, Ausgleich und Verständigung, und als lingua franca die kapitalistische Marktwirtschaft. Das Gute hat sich durchgesetzt, wir stehen Arm in Arm miteinander auf der Veranda der Weltgeschichte…
2/24, das bedeutet: Nichts von dem gilt mehr, gar nichts. Wir müssen realisieren: Schon seit langem war es nur mehr eine Illusion, wir würden mit diesem Staat Russland gemeinsame Werte teilen. Die osteuropäischen Stimmen lehren uns, wie sehr wir uns Sand in die Augen gestreut haben, denn nichts von dem, was wir für unverbrüchliche politisch-rechtliche Errungenschaften annahmen, hat Bestand: nicht das Gewaltverbot der UN-Charta, nicht die Anerkennung staatlicher Selbstbestimmung, nicht die KSZE-Standards einer auf Menschenrechten basierten staatlichen Ordnung und internationalen Kooperation.
Wir sind in Schockstarre
Mit einem Federstrich wird der Vorhang zerrissen, der unsere europäische Bühne so schön dekoriert hatte. Putin hat uns alle hinter die Fichte geführt, nicht nur die Ukraine. Wir Deutsche, Schweizer:innen, Westeuropäer:innen, stehen mit leeren Händen da, beraubt der Versprechungen, auf die wir vertraut hatten. Mein Eindruck ist: Wir sind in Schockstarre – und zwar mindestens ebenso über unsere eigene Sprach- und Antwortlosigkeit wie über die Not der Menschen in der Ukraine. Eine Schockstarre, weil wir so düpiert sind. Desillusioniert wie Naivlinge, weil unser Mindset nichts mehr taugt.
Aber womit gehen wir jetzt weiter?
1 .«Auf eure ganze Ordnung pfeif ich doch»
In den frühen 2000er Jahren bewegte ich mich viel in Gremien der kirchlichen Friedensethik. Der Einsatz der NATO im Kosovo-Krieg gegen Serbien stand im Fokus, Konflikte in Afrika, auch die indonesischen Versuche, Osttimor gewaltsam am Weg in die staatliche Unabhängigkeit zu hindern. Man hat versucht, Kriterien für das zu definieren, was man «humanitäre Interventionen» nannte. Ich habe noch in Erinnerung, wie der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer auf einem Grünen-Parteitag für die deutsche Beteiligung am NATO-Einsatz gegen die Soldateska von Slobodan Milošević warb: Gerade weil die Deutschen doch selbst – als Tätervolk – eine Geschichte mit dem Genozid haben, müssten sie diesem Einsatz zustimmen, auch wenn er ohne UN-Mandat erfolge…
Hintergrundannahme all dieser Debatten war stets, dass es galt, Regeln für den Ausnahmefall zu finden. Dass es solche Ausnahmen wohl immer wieder geben musste, das war traurig. Aber es ließ sich in das eigene Weltbild irgendwie einpreisen, da es ja die Regeln gibt. Und die bestehen in der Geltung einer Weltordnung, die nach dem Ende des Kalten Krieges und einer Belebung der Vereinten Nationen nicht anders als eben menschenrechtsbasiert und völkerrechtsförmig sein konnte. Wenn es nun noch zu Krieg und Gewalt kommen würde, dann allenfalls, weil einige sich noch nicht eingefunden hätten in die neue Zeit mit ihrem normativen Rahmen. Den gilt es umzusetzen, und die «Humanitäre Intervention», später als «Responsability to protect» (R2P) als UN-Resolution beschlossen, ist der Titel, unter dem sogar der Anspruch auf staatliche Souveränität – dem Völkerrecht sonst so heilig – ausgehebelt werden darf.
Die Illusion: Dass man nur noch Regeln für den Ausnahmefall benötigt.
Die Gesprächsrunden dieser Zeit in ihrer illustren Besetzung aus christlichen Pazifisten, Regionalexperten und friedensethisch sensiblen Militärs (und es waren wirklich alles nur Männer) verstanden sich als Orte des Vordenkens in der damals angebrochenen rot-grünen Epoche. Aber dieses Vordenken war bei aller Differenzierung im Grunde stets dem Rahmen verpflichtet, den Francis Fukuyama mit seinem auch damals schon angezweifelten Meisternarrativ vom Sieg des politischen Liberalismus als dem «End of history» vorgegeben hatte (hierzu vgl. diese Zusammenfassung).
Was damals nicht gedacht werden konnte, ist die Situation, vor der wir heute stehen. Dass jemand, der (ressourcenmäßig, kräftemäßig) relevant ist und kein Kleiner, über den man hinwegsehen kann, ganz offen sagt: Auf euren Ordnungsrahmen pfeif ich. Weil ich einen eigenen definiere. Wenn ich in euren Formaten mitmache, dann nur, weil sie mir gelegentlich nutzen. Aus dem Europarat ist Russland bereits ausgestiegen, damit auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Mal sehen, wie lange sie noch bei den UN mitmachen. Allzu oft werden sie sich die Schmach von 141:5-Entscheidungen nicht mitansehen wollen.
Damit haben wir genau das, was wir nie denken wollten. Recht des Stärkeren statt Stärke des Rechts. Ende des liberalen Traums. Dass man miteinander redet, manchmal ringt, sich verständigt, Regeln aufstellt, Verträge schliesst. Dass man – im Kern – Vertrauen aufbringt und nach der Wahrheit strebend handelt. Und in der Politik heisst das: dass man sich auf eine selbe, gemeinsam geteilte Wirklichkeit bezieht. Wenn ein Kinderspital beschossen wurde, dann wurde eines beschossen, weil eines da war, wo die Bomben runtergingen.
Der Krieg um die Ukraine ist längst ein universaler, ein Weltkonflikt.
Dieser Krieg zwingt uns zu sehen: Nichts mehr von dem, worauf unser Miteinandersein in Europa seit Mitte der 1970er Jahre aufgebaut war, gilt heute noch. Und wir haben keine Ausrede mehr, das nicht zu sehen. Man kann offenbar einen anderen Staat angreifen, wenn man stark genug ist. Man kann ignorieren, dass das ein Völkerrechtsbruch ist. Man braucht keinen legitimen Kriegsgrund. Man kann den Krieg auf eine Weise führen, wie es längst geächtet ist. Müssen wir nicht verstehen, dass der Angriff auf die Ukraine längst ein universaler, ein Weltkonflikt ist? Weil das Fundament unseres eigenen Selbstverständnisses als kollektiver politischer Akteur in dieser Welt aus den Angeln gehoben und in der Luft zerschossen worden ist?
2. Der Gestus christlicher Friedensethik: „Zwar-aber“
Es wird jetzt viel geraunt: Wir brauchen eine «neue Friedensethik», für diese neue Situation (vgl. z.B. hier). Die einen fordern das und meinen, die traditionelle kirchliche Friedensethik sei bisher zu zahm gewesen, für die neue Zeit nicht mehr passend. Und das ruft die anderen auf den Plan, den radikalen Pazifismus. Da wird die Ghandi-Option des umfassenden Gewaltverzichts vertreten, ganz egal, wem man gegenübersteht.
Ich glaube, das ist zu einfach. Ich denke, diese Friedensethik, wie sie sich etwa im Bild vom «Gerechten Frieden» ausdrückt (vgl. diesen Beschlusstext), hat ein Potential, das entfaltet werden kann. Dieses Ethos folgt nicht einer binären Wahl, die sagt: Entweder mit Gewalt oder ohne. Sie hat eine Präferenz und folgt darin der Struktur eines «Zwar-aber».
Diese Ethik sagt: Gewalt ist ein ganz schlechtes Mittel. Es löst Konflikte nicht wirklich. Im Gegenteil: Gewalt ruft neue Gewalt hervor, es gibt eine Eskalationsspirale, die nichts besser, sondern alles schlimmer macht. Sorgt euch stattdessen darum, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass einer meint, er müsse Gewalt anwenden, um seine Interessen durchzusetzen. «Entwicklung, der neue Name für Frieden», so schrieb schon 1967 Papst Paul VI. in seiner Sozialenzyklika «Populorum progressio» (vgl. hier). Das ist natürlich die beste Maxime nachhaltiger Friedensethik, weil sie nicht erst ansetzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern den Blick auf die Bedingungen richtet, unter denen Frieden wachsen kann. [ZWAR]
Was aber, wenn da ein Aggressor ist, der Gewalt einsetzt, dafür keine «causa iusta» (gerechten Grund) anführen kann, und der in seinem Vorgehen jede Regel der Verhältnismäßigkeit verrät? Dessen Gewalt nicht Korrektur, sondern Vernichtung zum Ziel hat? Dann mag Gewalt ein hinnehmbares (wenn auch nicht in sich gutes) Mittel sein, sofern sie verhältnismäßig, für das angemessene Ziel (Selbstverteidigung) und in der Absicht eingesetzt wird, es so bald als möglich durch andere, zivile Mittel der Konfliktbearbeitung zu ersetzen. [ABER]
3. Politisch existieren, das heißt leider: Es gibt Innen und Außen
Für eine Dimension sind die pazifistischen Visionen eines gewaltfreien Friedensethos blind. Es ist die Tatsache, dass ein friedliches Zusammenleben und die Achtung von Menschenrechten auf dieser Welt stets einem territorialen Faktor unterliegen: Das Miteinandersein von Menschen auf dieser Erde wird innerhalb einer sich politisch verfassenden Gemeinschaft organisiert, die wir üblicherweise ‘Staat’ nennen. Und diese politisch verfasste Gemeinschaft braucht es, um überhaupt Rechte geltend machen zu können. Ohne den Staat, seine rechtsetzenden und rechtsprechenden Institutionen, wären Menschen- und Grundrechte moralische Versprechungen, aber keine erfahrbare Wirklichkeit.
Politischer Existenz kann man nicht ausweichen. Und das heisst: wir leben notwendigerweise in territorial verfassten Räumen.
Es sind dies die Bedingungen einer politischen Existenz, um die wir alle nicht herum kommen. Wir können nicht anders als territorial zu leben, und das bedeutet: Dass wir eben nicht im Weltstaat leben und Regelverstöße allenfalls polizeilich zu ahnden hätten. Putins Angriff auf die Ukraine zeigt uns: Wir leben nationalstaatlich verfasst, und das heißt: unterworfen einer für die universalistische Moral, nach der wir alle lechzen, schwer zu akzeptierenden Logik von Innen und Außen. Was für uns gelten soll, muss der Andere nicht teilen, UN-Charta und Völkerrecht hin oder her. Russland zeigt das gerade: Eure Ordnung ist nicht unsere! Wir setzen unsere eigene und die oktroyieren wir euch auf.
Weil das so ist, kommt man mit der Ghandi-Option im Weltmaßstab häufig nicht weiter. Ukrainer:innen kämpfen dagegen, ihre Weise des Miteinander-Leben-Wollens (als ukrainischer Staat, gefestigt durch das identitätsbestärkende Momentum des Euromaidan) zu erhalten. Sie erwehren sich gegen die Auslöschung dieser Weise ihrer kollektiven Autonomie.
Miteinander leben wollen – das ist Ausdruck menschlicher Selbstbestimmung, im Politischen.
Ghandis Kampf erfolgte innerhalb eines bereits fremdbestimmten Gesamtrahmens – der britischen Kolonialherrschaft in Indien. Die Ukraine hingegen erwehrt sich mit allen Kräften gegen die feindliche Übernahme, die im indischen Kontext bereits geschehen war. Man mag es das «republikanische Moment» nennen und es spielt eine Rolle für die Frage, ob es legitim und angeraten ist, Gewalt einzusetzen: Sich dem Aggressor freiwillig zu ergeben, um mit zivilem Widerstand ihn danach wieder zu vertreiben – ohne irgendeine Aussicht, wieviele Jahrzehnte das dauern könnte, während der Hegemon Fakten schafft? Was für eine beinahe zynische Empfehlung, die sich friedensethisch als originell versteht (vgl. hier). Mein Eindruck ist: Solche Empfehlungen kommen aus einem (West-) Deutschland, das sein politisches Existieren-Dürfen nicht selbst erringen musste, sondern das es (vor allem von Amerika) geschenkt bekam. Und warum nur, das frage ich mich, wird der Ghandi-Appell so oft ans Aggressionsopfer gerichtet (Selenskyj soll nicht immer mehr Waffen fordern), nicht aber zuerst an den barbarisch auftretenden Aggressor adressiert?! Es ist der blinde Fleck bei so vielen friedensbewegten Appellen.
4. Einstehen für das, was uns wichtig ist
Wenn die Waffen irgendwann einmal schweigen, werden wir nicht nur das Ausmass von Zerstörung und Leid in der Ukraine ermessen können, sondern auch uns selbst befragen müssen: Wer sind wir eigentlich, angesichts der veränderten Koordinaten unserer kollektiven politischen Existenz? Das hat Auswirkungen, die ans Eingemachte gehen und neue Antworten erfordern. Haben wir das schon gespürt? Lassen wir das zu?
- Sollte der russische Okkupationsanspruch scheitern, das ukrainische Volk als moralischer Gewinner aus dem Konflikt hervorgehen – ist das dann ein «Sieg» westlicher Werte? Ganz sicher nicht im Sinne eines um 1989/90 verkündeten «Endes der Geschichte»! Die Lehre wird sein: Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte sind prekäre Güter. Sie müssen immer wieder gesichert und auch neu erkämpft werden. Wir Mitteleuropäer:innen zehren davon, dass andere sie in unserer Peripherie erstreiten, unter Einsatz ihrer Existenz. Das sollte uns – in unserer politischen Existenzweise – demütig machen. Und das heißt konkret: kooperativ und zum Verzicht bereit. Mutig und wehrhaft.
- Auf lange Zeit wohl sind wir aus dem Nest gefallen, in das wir uns mit dem «Ende des Ost-West-Konfliktes» gerettet zu haben meinten. Wie gehen wir damit um? Zu realisieren, dass direkt neben uns ein Hegemon ist, der nicht davor scheut, barbarische Kriege als Mittel seiner Politik zu begreifen und dem seine Zusagen («Minsker Abkommen», «Genfer Konvention», «Helsinki-Schlussakte», «Budapester Memorandum», haha…) nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben sind? Der den Krieg gegen Kiew vielleicht auf dem Felde nicht gewinnen kann, der aber nichts dagegen hat, mit einer Politik der verbrannten Erde und immer neuen Offensiven aus Rache und Zermürbung jeden Neuanfang in der Ukraine unmöglich zu machen? Der damit dem Westen den Mittelfinger zeigt und uns grinsend ins Gesicht sagt: Ihr seid längst im Krieg mit uns, und genau das wollten wir, euch eure Grenzen aufzeigen… Wie lange wollen wir Westliche damit leben, dass die Opfer dieser Haltung zuerst die Ukrainer:innen sind und dann wir selbst, die wir unser Leben «ohne wirtschaftliche Verwerfungen» (so begründet die deutsche Ampel-Regierung die Ablehnung weiterer Sanktionen) weiterleben wollten.
- Wir können nicht meinen: Die globale Verflechtung gibt es nur auf der einen Seite: wenn es uns Vorteile in Konsum und Lebenschancen bringt. Haben wir nicht alle irgendwie im Kopf: Der Krieg, das ist eine Sache zwischen den beiden Kriegsparteien, wir halten uns da raus, helfen humanitär, aber leben unser komfortables Leben ansonsten weiter?! Die westliche Politik mit ihrem Mantra «Das darf kein dritter Weltkrieg werden» befördert diese Illusion. Wer oder was kann uns wachrütteln? Die hundertausende Menschen, die hier ankommen? Die steigenden Preise? Die sich zurückdrehende Globalisierung – was Mobilität und Wertschöpfungsketten anbelangt? Wann realisieren wir, dass der Krieg der Waffen längst einen den Waffenlärm überdauernden Konflikt zum Ausdruck bringt, dem wir uns stellen müssen: Wie stehen wir ein in dieser Welt für das, was uns wichtig ist und uns ausmacht? Denn wir realisieren: Jederzeit kann es uns genommen werden.
Ich merke es in den Gesprächen mit meinem bald zehnjährigen Sohn, der sich so gern über Politik unterhält und die Welt verstehen möchte: Ich kann ihm diese Welt nicht mehr auf die Weise erklären, wie ich es immer getan hatte. Ich selbst hatte daran geglaubt, dass es Absprachen gibt, an die man sich halten will. Dass Recht und Gesetz einen «harten Kern» haben und nicht beliebig instrumentalisiert werden. Dass die Menschenrechte sich auf lange Sicht durchsetzen würden. Es war eine Welt beseelt von dem Glauben, dass das Gute irgendwann gewinnen wird.
Mein Bild als Deutscher, als Europäer ist aus den Fugen. Was gebe ich weiter? Wir können es uns gar nicht leisten, keine Held:innen sein zu wollen.
—
Dr. Daniel Bogner lehrt Moraltheologie und theologische Ethik an der Universität Fribourg/CH. Er ist Mitglied der Redaktion von feinschwarz. In den 2000er Jahren war er Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Frieden der Deutschen Kommission Justitia et Pax.
Bild: tagesschau.de